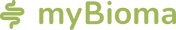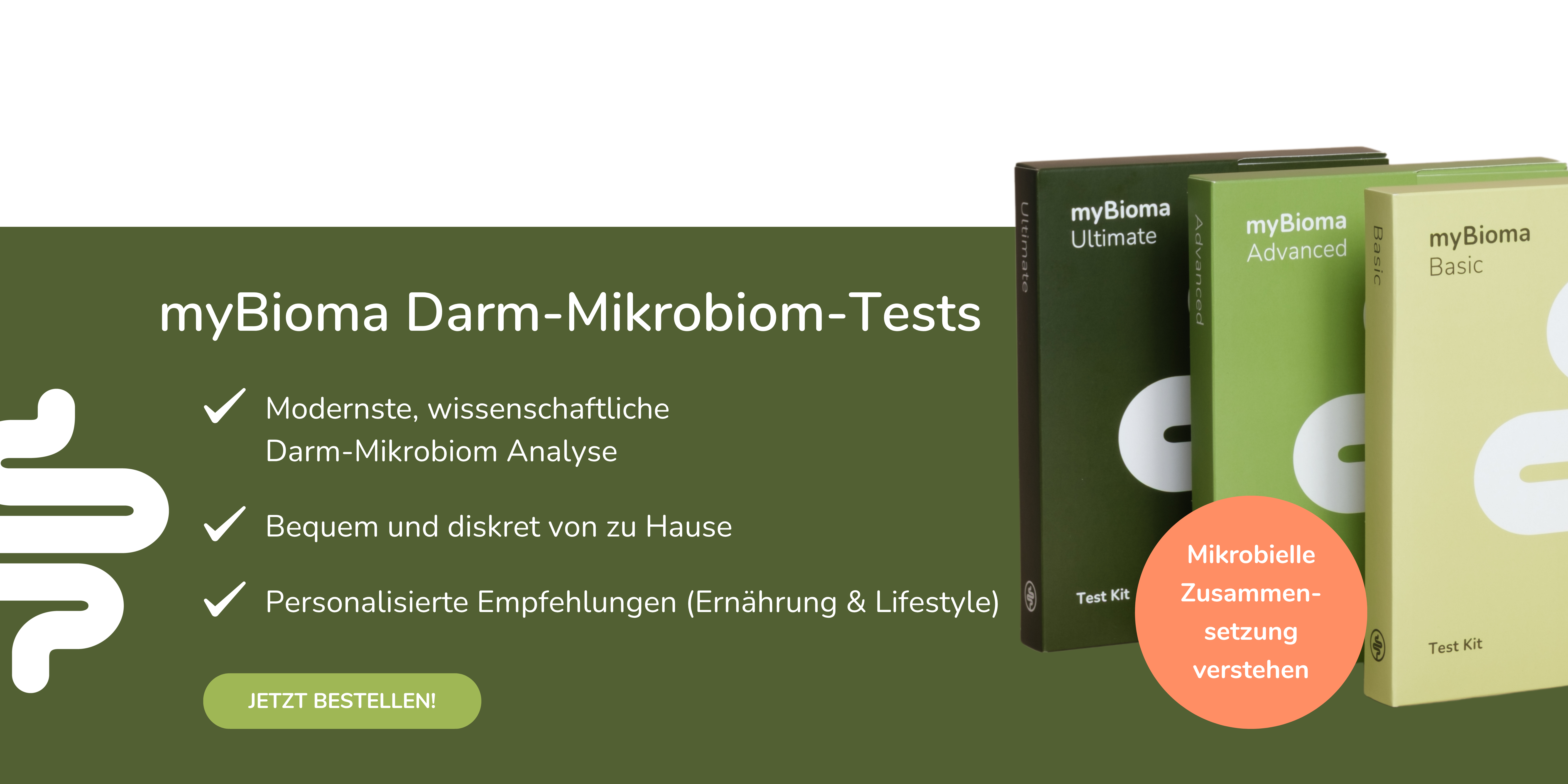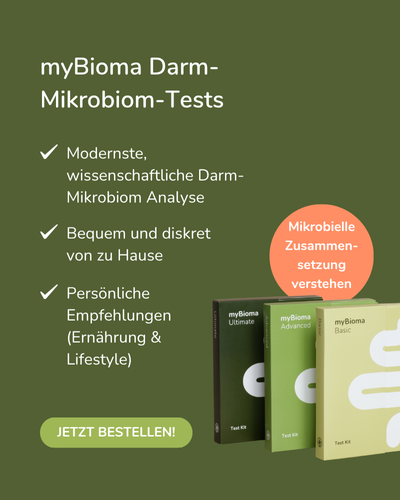Inhaltsverzeichnis
- Wie entsteht der Blutdruck im Körper?
- Wie wird der Blutdruck geregelt?
- Risiken von Bluthochdruck – und warum auch ein niedriger Blutdruck ein Thema ist
- Das Mikrobiom als Blutdruckregulator
- Ist Salz der Bösewicht und führt zu Bluthochdruck?
- Welche Ernährungsform wird bei Bluthochdruck empfohlen?
- Wie kann ich mit meiner Ernährung Blutdruck und Mikrobiom unterstützen?
- Kaffee und Blutdruck – Genuss oder Risiko?
- Probiotika als Hoffnungsträger bei Bluthochdruck?
- Fazit - Dein Darm-Mikrobiom unterstützt einen gesunden Blutdruck
Bluthochdruck gehört zu den größten Gesundheitsproblemen unserer Zeit. Fast jeder dritte Erwachsene ist betroffen – oft ohne es zu wissen. Trotz kontinuierlicher Entwicklung neuer blutdrucksenkender Medikamente und neuer Therapiemethoden, zeigt sich der Kampf gegen Bluthochdruck in der Gesellschaft - und damit gegen den wichtigsten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - wenig zufriedenstellend (1). Zunehmend rückt hier das Darm-Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien in unserem Darm, immer stärker in den Fokus der Forschung. Überraschend, aber gut belegt: Der Zustand unserer Darmflora kann den Blutdruck beeinflussen. Dieses Wissen könnte neue Wege zur Vorbeugung und Behandlung eröffnen und bringt praktische Tipps für den Alltag.
Wie entsteht der Blutdruck im Körper?
Der Blutdruck entsteht durch das Zusammenspiel von Herz und Blutgefäßen. Das Herz wirkt dabei wie eine Pumpe: Mit jedem Schlag zieht es sich zusammen und presst Blut in die Arterien. Dadurch baut sich Druck auf den Gefäßwänden auf – das ist der systolische Blutdruck. Wenn sich das Herz wieder entspannt und mit Blut füllt, bleibt ein Grunddruck in den Gefäßen bestehen, der diastolische Blutdruck. Auch die Gefäße selbst tragen dazu bei: Die großen Arterien dehnen sich beim Herzschlag und ziehen sich anschließend wieder zusammen, sodass das Blut gleichmäßig weiterfließt. Kleine Arterien können sich verengen oder weiten und so den Widerstand im Kreislauf regulieren. Auf diese Weise sorgt der Körper dafür, dass alle Organe kontinuierlich mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden (2,3).
Der systolische und diastolische Blutdruck geben Auskunft darüber, wie stark das Herz-Kreislauf-System belastet ist. Als normal gelten Werte unter 130/85 mmHg. Liegt der Blutdruck dauerhaft über 140/90 mmHg, spricht man von Bluthochdruck (Hypertonie), der das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Werte unter 100/60 mmHg bezeichnet man dagegen als niedrigen Blutdruck (Hypotonie) (2).
💡 Männer sind häufiger von Bluthochdruck betroffen, ab der Menopause ändert sich dies jedoch und das Risiko steigt auch bei Frauen stärker an (4).
Wie wird der Blutdruck geregelt?
Damit der Blutdruck stabil bleibt, verfügt der Körper über verschiedene Regelmechanismen: Speziell empfindliche Sensoren in den Halsgefäßen und in der Aorta messen ständig den Druck. Steigt oder fällt er, senden sie Signale ans Gehirn und passen innerhalb von Sekunden Herzschlag und Gefäßweite an, damit der Blutdruck stabil bleibt (2). Mittelfristig greifen auch die Nieren ein, indem sie Hormone wie Renin freisetzen, die die Gefäße verengen. Außerdem produziert das Herz bestimmte Hormone, die die Gefäße erweitern und die Ausscheidung von überschüssigem Salz über die Nieren fördern (5). Auch langfristig regulieren die Nieren den Salz- und Wasserhaushalt und damit das Blutvolumen.
Alltägliche Faktoren wie der Flüssigkeitsverlust beim Schwitzen oder eine salzreiche Ernährung können den Blutdruck ebenfalls beeinflussen– der Körper gleicht diese Schwankungen jedoch meist zuverlässig aus (2).
Auch verändert sich die Höhe des Blutdrucks im Laufe des Tages. Beispielsweise steigt er nach dem Aufwachen stark an und sinkt gegen Abend und in der Nacht wieder ab. Faktoren wie Geschlecht, Alter und Lebensstil wirken sich zudem auf den Blutdruck aus. Körperliche Aktivität wie Sport erhöht den Blutdruck, da die Muskeln mehr Sauerstoff benötigen. Auch Stress, Wut oder Ärger können den Blutdruck spürbar in die Höhe treiben (2).
💡 Gefährlich wird ein erhöhter Blutdruck erst, wenn er längerfristig hoch ist oder sehr stark schwankt. Die soeben erwähnten, alltäglichen und im Normalfall kurzfristigen Veränderungen sind meist harmlose Vorgänge im Körper und zeigen nur, dass der Körper flexibel auf verschiedene Situationen reagieren kann.
Risiken von Bluthochdruck – und warum auch ein niedriger Blutdruck ein Thema ist
Bluthochdruck schädigt auf Dauer Gefäße, Herz und Nieren und gilt als einer der stärksten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die Ursachen für Bluthochdruck können vielfältig sein und umfassen sowohl genetische als auch Umweltfaktoren. Beteiligt an der Entstehung ist häufig eine Hyperaktivität des sympatischen Nervensystems (der „aktivierende, anregende“ Teil des Nervensystems), Hormone, steife oder weniger elastische Blutgefäße, Stoffwechselprobleme sowie ein Ungleichgewicht anderer körpereigener Botenstoffe (1).
Ein zu niedriger Blutdruck ist seltener gefährlich, kann aber Schwindel, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme verursachen (2). Sowohl bei einer Hypertonie (Bluthochdruck) als auch bei einer Hypotonie (niedriger Blutdruck) kann das Mikrobiom beteiligt sein – denn es kann Gefäßweite, Nervenreizleitung und Entzündungsprozesse beeinflussen. Aber dazu gleich mehr!

Auch als Darm-Herz-Achse bekannt: Die Zusammensetzung der Darmflora zeigt einen Einfluss auf unseren Blutdruck und unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit.
Das Mikrobiom als Blutdruckregulator
In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass unser Darm-Mikrobiom eine wichtige Rolle bei der Regulation des Blutdrucks spielt. Darmbakterien produzieren Stoffwechselprodukte wie kurzkettige Fettsäuren (SCFAs), die in den Blutkreislauf gelangen und dort auf verschiedene Organe wirken – etwa auf Nieren, Herz, Blutgefäße und das Nervensystem. Dadurch können sie Blutdruck regulierende Prozesse beeinflussen (6). Gleichzeitig zeigen Studien, dass ein Ungleichgewicht der Darmflora (Dysbiose) eng mit Bluthochdruck verknüpft ist und hypertensive Personen eine verringerte Vielfalt (Diversität) im Darm aufweisen (6,7). Auch umgekehrt scheint ein bestehender Bluthochdruck Einfluss auf die Zusammensetzung der Darmflora zu haben und kann ein Ungleichgewicht begünstigen (6).
Das Mikrobiom eines Menschen mit Bluthochdruck zeigt oft die folgenden Muster (1):
- Dysbiotisches (unausgeglichenes) Mikrobiom
- Verringerte Barrierefunktion der Darmschleimhaut
- Erhöhte Anzahl an Bakterien, die potenziell schädliche Substanzen produzieren
- Verringerte Anzahl an nützlichen Bakterien und kurzkettigen Fettsäuren
Durch diese Mechanismen können deine Darmbewohner einen Einfluss auf den Blutdruck nehmen:
Kurzkettige Fettsäuren (SCFAs; engl. Short Chain Fattty Acids)
SCFAs wie Acetat, Propionat und Butyrat entstehen, wenn die Bakterien im Darm Ballaststoffe verstoffwechseln. Im Blutkreislauf angekommen wirken sie unter anderem gefäßerweiternd, entzündungshemmend und blutdrucksenkend, indem sie an bestimmte Rezeptoren im Körper binden. Untersuchungen der mikrobiellen Zusammensetzung zeigen, dass bei Personen mit Bluthochdruck grundsätzlich weniger SCFA-produzierende Bakterien im Darm vorhanden sind. Spannenderweise zeigt sich in manchen Studien häufig auch eine erhöhte Ausscheidung von SCFA über den Stuhl bei Hypertoniker:innen. Vermutet wird, dass hier eine Störung bei der Aufnahme von SCFA in den Blutkreislauf zugrunde liegt – d.h. in diesem Falle werden zwar nicht zu wenige kurzkettige Fettsäuren produziert, jedoch werden viele davon nicht in den Körper aufgenommen und mit dem Stuhl ausgeschieden (6). In beiden Szenarien führt das aber zu dem gleichen Ausgangsproblem - dass zu wenige kurzkettige Fettsäuren im Körper zur Verfügung sind.
Erste Experimente an Tieren oder menschlichem Gewebe im Labor haben gezeigt, dass eine direkte Gabe von SCFAs den Blutdruck potenziell senken kann (6). Das könnte ein interessanter Anhaltspunkt für zukünftige Therapien bei bestehendem Bluthochdruck sein – weitere Studien, auch an Menschen, sind hier jedoch unbedingt nötig.
TMAO und andere Metabolite
Neben den nützlichen SCFAs können die Darmbakterien auch Stoffwechselprodukte bilden, die eher einen negativen Einfluss auf den Blutdruck haben. Besonders gut untersucht ist das Trimethylamin-N-Oxid (TMAO). Dabei wandeln die Mikroben im Darm Nahrungsbestandteile aus tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Eiern in Trimethylamin (TMA) um, das in der Leber zu TMAO weiterverarbeitet wird. Chronisch erhöhte TMAO-Spiegel stehen im Zusammenhang mit Störungen der Nierenfunktion und können den Blutdruck über verschiedene hormonelle Signalwege beeinflussen (6).
Auch andere Substanzen wie Gallensäuren oder Wasserstoffsulfid (H₂S), die vom Darm-Mikrobiom gebildet werden, wirken auf die Gefäßfunktion und Blutdruckregulation ein. Die beiden Substanzen gelten grundsätzlich als gefäßerweiternd und können so den Blutdruck senken. Wichtig ist jedoch: Hier ist in beiden Fällen die Dosis entscheidend – gerät das Gleichgewicht durcheinander und es wird durch ein unausgewogenes Darm-Mikrobiom zu viel oder zu wenig der beiden Substanzen produziert, kann sich das Risiko für Bluthochdruck erhöhen (1).
Darmbarriere und Entzündung
Ein weiteres wichtiges Puzzlestück ist die Darmbarriere. Ist diese durch eine Dysbiose geschwächt, können bakterielle Bestandteile wie Lipopolysaccharide (LPS) in den Blutkreislauf gelangen. Das triggert chronische Entzündungen, die Blutgefäße schädigen und den Blutdruck erhöhen können. Studien zeigen, dass Menschen mit Bluthochdruck häufiger eine gestörte Darmbarriere und erhöhte Entzündungsmarker aufweisen (7).
Die Darm-Hirn-Achse
Auch die Darm-Hirn-Achse (über die der Darm und das Gehirn miteinander kommunizieren) kann eine Rolle bei der Bludruckregulierung spielen. Gerät dieses Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht, kann das sympathische Nervensystem überaktiv werden. Dieses steuert unter anderem den Herzschlag und die Gefäßspannung – eine dauerhafte Überaktivierung kann so den Blutdruck erhöhen und auch zur Entstehung von Hypertonie beitragen (6).
Weitere spannende Informationen, wie du dein Nervensystem regulieren kannst und wie deine Darmgesundheit davon profitieren kann, findest du in unserem ausführlichen Blog: Achtsamkeit, Vagusnerv & Darmgesundheit: Wie du dein Nervensystem regulierst und dein Wohlbefinden stärkst.
💡 Es wird stark vermutet, dass neben den eben erwähnten Faktoren, das Mikrobiom auch noch über weitere, bisher unbekannte Mechanismen die Blutdruckregulation beeinflusst.

Studien legen nahe: Deine Darmbakterien können über mehrere Mechanismen einen Einfluss auf deinen Blutdruck haben.
Der Darm-Mikrobiom-Test Ultimate zeigt dir, wie stark dein Mikrobiom deine Blutdruckregulation unterstützt und wie vielfältig deine Darmflora ist – so kannst du deinen Körper besser vestehen lernen. Weitere Informationen zum Testumfang und -ablauf findest du hier: https://mybioma.com/products/mikrobiom-test-ultimate
Ist Salz der Bösewicht und führt zu Bluthochdruck?
Salz wird immer als großer Einflussfaktor für den Blutdruck aufgezählt – aber spielt es tatsächlich eine so große Rolle?
Ganz generell beantwortet: Ja, die Salzaufnahme kann einen Einfluss auf den Blutdruck haben. Allerdings reagieren Menschen unterschiedlich stark darauf. Manche sind salzsensitiv, das bedeutet, durch eine genetische Prädisposition steigt ihr Blutdruck bei höherer Kochsalzzufuhr deutlich an, während andere kaum darauf reagieren (5). Spannenderweise zeigen Studien zudem, dass diese Salzsensitivität häufiger bei Frauen vorkommt als bei Männern (4).
Neuere Studien deuten außerdem darauf hin, dass Veränderungen der Darmflora zu salzbedingtem Bluthochdruck beitragen können (8): Beispielsweise kann eine übermäßige Salzzufuhr nützliche Bakterienstämme wie Laktobazillen verringern – das kann zu Bluthochdruck beitragen (1). Die genauen Mechanismen hierfür sind jedoch noch nicht vollständig geklärt.
Welche Ernährungsform wird bei Bluthochdruck empfohlen?
Wenn es um Ernährung und Blutdruck geht, stehen zwei Konzepte besonders im Rampenlicht: die Mediterrane Ernährung und die DASH-Diät. Beide sind wissenschaftlich gut untersucht – und beide haben ihre Stärken.
Die Mediterrane Ernährung gilt als echter Allrounder. Sie setzt auf viel buntes Gemüse und Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Olivenöl, Nüsse und Fisch, während rotes oder verarbeitetes Fleisch nur selten auf den Teller kommt. Ihr Geheimnis liegt in der Kombination aus Ballaststoffen und Polyphenolen – pflanzliche Schutzstoffe, die in Olivenöl, Beeren, Äpfeln oder in Nüssen stecken. Diese Stoffe fördern ein vielfältiges Mikrobiom, hemmen Entzündungen und regen die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs) an, die die Gefäße entspannen und den Blutdruck senken können (9).
Die DASH-Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension) dagegen wurde gezielt zur Blutdrucksenkung entwickelt. Sie setzt auf Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und fettarme Milchprodukte und reduziert rotes Fleisch, Zucker und gesättigte Fette deutlich. Besonders in Kombination mit einer salzarmen Ernährung kann sie eine starke blutdrucksenkende Wirkung zeigen– vor allem bei Menschen mit Hypertonie (9).
________________________________________________________________________
Praktische Checkliste für den Alltag:
- Täglich: Gemüse (mind. 2 Portionen), Obst (1–2 Portionen), Vollkornprodukte.
- Mehrmals pro Woche: Hülsenfrüchte, Nüsse, Fisch, fettarme Milchprodukte.
- Fette bewusst wählen: Olivenöl statt Sonnenblumenöl oder Margarine.
- Salz reduzieren: Fertigprodukte meiden, Wurst und Käse in Maßen konsumieren, Kräuter & Gewürze nutzen.
- Selten: rotes Fleisch, Zucker, stark verarbeitete Lebensmittel.
________________________________________________________________________
Wie kann ich mit meiner Ernährung Blutdruck und Mikrobiom unterstützen?
Ballaststoffe & Präbiotika – Nahrung für SCFA-produzierende Bakterien
Unsere Darmbakterien lieben Ballaststoffe – sie sind sozusagen ihr „Lieblingsfutter“. Wer regelmäßig Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse isst, liefert den Mikroben reichlich Nahrung. Aus diesen Fasern stellen die Bakterien wertvolle kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) her, die die Gefäße entspannen und den Blutdruck senken können. Außerdem sorgen sie für ein ausgeglichenes Mikrobiom. Präbiotika – unverdauliche Ballaststoffe aus Lebensmitteln wie Zwiebeln, Knoblauch oder Hafer – wirken wie ein „Superdünger“ für deine Darmflora. Sie liefern den guten Bakterien genau das, was sie zum Wachsen und Arbeiten brauchen.
Natürliche Pflanzenstoffe – kleine Helfer für Darm und Herz
Natürliche Pflanzenstoffe, insbesondere Polyphenole, sind kleine, aber wirkungsvolle Helfer für Darm und Herz-Kreislauf-System. Sie kommen reichlich in Lebensmitteln wie Orangen, roten Früchten, Äpfeln, Kakao, Olivenöl, Nüssen und Trauben vor. Im Darm werden Polyphenole von den Mikroben in kleinere, bioaktive Verbindungen umgewandelt, die anschließend ins Blut gelangen und dort Entzündungen hemmen, die Gefäßfunktion verbessern und so den Blutdruck positiv beeinflussen können (1,9).
Darüber hinaus fördern Polyphenole das Wachstum nützlicher Darmbakterien. So wurden zum Beispiel durch den Konsum von Olivenöl vermehrt Lactobacillus, Bifidobacterium und Clostridium nachgewiesen. Quercetin, ein Polyphenol in Äpfeln, Beeren und roten Früchten, unterstützt die Vielfalt des Mikrobioms und kann die Darmgesundheit stabilisieren. Resveratrol aus Trauben wirkt zusätzlich blutdrucksenkend. Auch Nüsse tragen zur Förderung gesunder Darmbakterien bei und unterstützen die Produktion kurzkettiger Fettsäuren.
Können nitratreiche und kaliumreiche Lebensmittel bei der Blutdruckregulation helfen?
Die Antwort lautet auch hier: Ja. Nitratreiche Lebensmittel wie Rote Bete, Rucola, Spinat oder Fenchel liefern Vorstufen für Stickstoffmonoxid (NO), ein Molekül, das die Blutgefäße erweitert und elastischer macht. Studien zeigen: Schon ein Glas Rote-Bete-Saft am Tag kann kurzfristig den systolischen Blutdruck etwas senken. Der Effekt kann besonders bei Menschen mit Bluthochdruck spürbar sein.
Kaliumreiche Lebensmittel – etwa Bananen, Kartoffeln, Nüsse, Hülsenfrüchte oder Spinat – wirken über einen anderen, aber ebenso wichtigen Mechanismus. Sie helfen, überschüssiges Natrium (Salz) auszuscheiden, und bringen das empfindliche Gleichgewicht von Natrium und Kalium im Körper wieder in Balance. Das entlastet die Gefäße und schützt langfristig Herz und Nieren.
💡 Praktischer Tipp: Wer regelmäßig zu frischem Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst greift, verbindet beide Vorteile: Kalium reguliert den Salzhaushalt, Nitrat sorgt für entspannte Gefäße. Schon kleine Veränderungen – etwa öfter Kartoffeln statt Weißbrot, einen Rote-Bete-Salat zum Mittagessen oder eine Handvoll Nüsse als Snack – können dazu beitragen, den Blutdruck im Alltag zu stabilisieren.
Die Integration von nitratreichen oder kaliumreichen Lebensmitteln kann keine Therapie gegen Blutdruck ersetzen, aber unterstützend eingesetzt werden.
Kaffee und Blutdruck – Genuss oder Risiko?
Kaffee kann den Blutdruck kurzfristig erhöhen, vor allem bei Menschen, die selten Kaffee trinken. Wer regelmäßig Kaffee trinkt, gewöhnt sich meist daran, sodass der Effekt schwächer ausfällt. Interessanterweise deuten Studien darauf hin, dass moderater Konsum (2–4 Tassen täglich) sogar mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden sein kann – vermutlich dank der vielen Polyphenole und Antioxidantien im Kaffee.
Allerdings reagiert jeder unterschiedlich: Manche bauen Koffein langsamer ab und reagieren mit Herzklopfen oder stärkerem Blutdruckanstieg. Für andere bleibt Kaffee weitgehend unproblematisch.
💡 Das bedeutet: Kaffee ist bei Bluthochdruck kein generelles Tabu – wichtig sind die Menge sowie die individuelle Verträglichkeit.
Probiotika als Hoffnungsträger bei Bluthochdruck?
Immer mehr Studien zeigen, dass Probiotika – also lebende, nützliche Bakterien – nicht nur die Darmgesundheit fördern, sondern auch den Blutdruck positiv beeinflussen können. Eine Meta-Analyse von 14 klinischen Studien mit über 700 Patient:innen zeigte, dass probiotisch fermentierte Milchprodukte den Blutdruck deutlich senken können. Besonders spannend: Menschen mit Bluthochdruck haben oft ein weniger vielfältiges Mikrobiom. Ernährung spielt dabei eine zentrale Rolle – so reduziert eine salzreiche Kost wichtige Bakterien wie Lactobacillus, was den Blutdruck steigen lassen kann. Wird Lactobacillus jedoch gezielt zugeführt, etwa über Probiotika oder probiotische Lebensmittel, kann sich der Blutdruck wieder stabilisieren (1). Weitere Studien an Menschen werden hier jedoch noch benötigt.
Probiotische Lebensmittel sind beispielsweise Kefir, Sauerkraut, Joghurt, Kimchi, Brottrunk oder fermentiertes Gemüse.

Mithilfe der richtigen Ernährung kann man eine gesunde Blutdruckregulation und ein vielfältiges, gesundes Mikrobiom fördern.
Lebensstilanpassungen für einen gesunden Blutdruck und das Mikrobiom
Mit ein paar gezielten Maßnahmen kann nicht nur die Darmgesundheit gefördert, sondern auch das Herz und die Gefäße unterstützt werden.
Bewegung, Gewicht & Lebensstil
Regelmäßige Bewegung, zum Beispiel Radfahren, Walken oder Schwimmen, fördert die Vielfalt der Darmbakterien und senkt den Blutdruck (10). Auch ein gesundes Körpergewicht spielt eine große Rolle: Bei bestehendem Übergewicht können bereits wenige Kilo weniger den Blutdruck deutlich senken.
Entspannung für gesunden Blutdruck
Chronischer Stress ist ein häufiger, oft unterschätzter Faktor, der den Blutdruck in die Höhe treiben kann. Deshalb ist es besonders wichtig, im Alltag bewusst Ruhephasen einzubauen. Regelmäßige Entspannungstechniken helfen, die Stressreaktionen des Körpers zu dämpfen, die Gefäße zu entspannen und langfristig den Blutdruck zu stabilisieren. Beliebte Methoden sind zum Beispiel Atemübungen, Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung. Schon wenige Minuten täglich können spürbar wirken: Die Atmung wird ruhiger, der Herzschlag gleichmäßiger, und der Körper schüttet weniger Stresshormone aus. Auch kleine Routinen, wie Spaziergänge in der Natur, ein heißes Bad oder Musik hören, tragen dazu bei, Stress abzubauen und das Herz-Kreislauf-System zu entlasten. Wer regelmäßig Entspannung in den Alltag integriert, schützt nicht nur seine Gefäße, sondern steigert gleichzeitig das allgemeine Wohlbefinden.
Medikamente & Darmgesundheit
Blutdruckmedikamente wirken in der Regel zuverlässig, können jedoch das Mikrobiom verändern – was wiederum die Blutdruckregulation beeinträchtigen kann. In der Folge kann es passieren, dass zunehmend mehr Medikamente erforderlich werden. Antibiotika lassen sich gezielt einsetzen, um eine bestehende Dysbiose im Darm zu behandeln und anschließend die Darmflora wieder aufzubauen. Allerdings bergen sie Nebenwirkungen und erfordern ein hohes Maß an Eigeninitiative – etwa durch gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Stressmanagement und guten Schlaf. Ihr Einsatz sollte daher stets unter ärztlicher Empfehlung und Aufsicht erfolgen (1).
Das orale Mikrobiom und der Blutdruck
Nicht nur der Darm, auch die Bakterien in unserem Mund spielen eine Rolle für den Blutdruck. Bestimmte Mundbakterien wandeln Nitrat aus Lebensmitteln wie grünem Blattgemüse in Nitrit um, das dann zu Stickstoffmonoxid (NO) verarbeitet wird. NO entspannt die Blutgefäße und kann so den Blutdruck senken. Studien zeigen, dass dieser Effekt verloren geht, wenn die Mundflora beispielsweise durch stark antibakterielle Mundspüllösungen gestört wird. Auch eine gesunde Mundflora kann also helfen, Herz und Gefäße zu unterstützen (11).
________________________________________________________________________
Kleine Tricks mit großer Wirkung für den Blutdruck
- Alkohol in Maßen: Täglich maximal ein kleines Glas Wein oder 0,25 l Bier - besser ist es jedoch, ganz darauf zu verzichten.
- Stress abbauen & gut schlafen: Kurze Pausen, Atemübungen, Meditation oder Spaziergänge in der Natur helfen, Stress zu reduzieren und den Blutdruck zu senken.
- Rauchen vermeiden: Schon nach einer rauchfreien Woche sinkt der Blutdruck, nach zwei Jahren ist das Risiko fast wie bei Nichtrauchern.
- Bewegung: Im Optimalfall mindestens 30 Minuten Ausdauersport an fünf Tagen pro Woche. Treppen steigen oder kurze Spaziergänge im Alltag unterstützen zusätzlich Herz und Darm.
- Orale Hygiene: Zweimal täglich Zähne putzen und abends Zahnseide nutzen. Auf starke antibakterielle Mundspülungen besser verzichten – klares Wasser nach dem Essen reicht oft schon aus, um die guten Bakterien im Mund zu schützen.
________________________________________________________________________
Fazit - Dein Darm-Mikrobiom unterstützt einen gesunden Blutdruck
Das Mikrobiom ist längst mehr als nur ein Verdauungshelfer: Es beeinflusst über Stoffwechselprodukte unter anderem direkt unsere Blutgefäße und damit den Blutdruck. Die Forschung zeigt, dass ein ausgewogenes Mikrobiom mit einem stabileren Blutdruck verbunden ist. Eine darmfreundliche Lebensweise könnte deshalb ein wichtiger Baustein der Bluthochdruck-Prävention werden. Schon kleine Schritte wie etwas mehr Gemüse, ein täglicher Spaziergang und eine Salzreduktion können helfen, das Mikrobiom in Balance zu bringen und eine gesunde Blutdruckregulation zu unterstützen.
Du möchtest Produkt-News als Erste*r erfahren und exklusive Rabatte, Rezepte und mehr erhalten? Dann werde jetzt Teil unseres HAPPY GUT CLUBs auf WhatsApp: myBioma Happy Gut Club
Für dich. Für deinen Darm.
Referenzen
- Yang, Z., Wang, Q., Liu, Y., Wang, L., Ge, Z., Li, Z., Feng, S., & Wu, C. (2023). Gut microbiota and hypertension: Association, mechanisms and treatment. Clinical and Experimental Hypertension, 45(1), 2195135. https://doi.org/10.1080/10641963.2023.2195135
- Stiftung Gesundheitswissen. (o. J.). Blutdruckregulation: Was steuert den Blutdruck? https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/unser-koerper/blutdruckregulation
- Stimpel, M. (2001). Blutdruck und Blutdruckregulation. In M. Stimpel, Arterielle Hypertonie (S. 3–17). Steinkopff. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57617-1_1
- Masenga, S. K., Wandira, N., Cattivelli-Murdoch, G., Saleem, M., Beasley, H., Hinton, A., Ertuglu, L. A., Mwesigwa, N., Kleyman, T. R., & Kirabo, A. (2025). Salt sensitivity of blood pressure: Mechanisms and sex-specific differences. Nature Reviews Cardiology, 22(9), 611–628. https://doi.org/10.1038/s41569-025-01135-0
- Jordan, J. (2015). Pathophysiologie der Hypertonie: Was sind unsere aktuellen Vorstellungen? Der Internist, 56(3), 219–223. https://doi.org/10.1007/s00108-014-3572-0
- Poll, B. G., Cheema, M. U., & Pluznick, J. L. (2020). Gut Microbial Metabolites and Blood Pressure Regulation: Focus on SCFAs and TMAO. Physiology, 35(4), 275–284. https://doi.org/10.1152/physiol.00004.2020
- O’Donnell, J. A., Zheng, T., Meric, G., & Marques, F. Z. (2023). The gut microbiome and hypertension. Nature Reviews Nephrology, 19(3), 153–167. https://doi.org/10.1038/s41581-022-00654-0
- Elijovich, F., Laffer, C. L., Sahinoz, M., Pitzer, A., Ferguson, J. F., & Kirabo, A. (2020). The Gut Microbiome, Inflammation, and Salt-Sensitive Hypertension. Current Hypertension Reports, 22(10), 79. https://doi.org/10.1007/s11906-020-01091-9
- Zambrano, A. K., Cadena-Ullauri, S., Ruiz-Pozo, V. A., Tamayo-Trujillo, R., Paz-Cruz, E., Guevara-Ramírez, P., Frias-Toral, E., & Simancas-Racines, D. (2024). Impact of fundamental components of the Mediterranean diet on the microbiota composition in blood pressure regulation. Journal of Translational Medicine, 22(1), 417. https://doi.org/10.1186/s12967-024-05175-x
- Schunkert, Prof. Dr. med. H. (o. J.). Blutdruck natürlich senken: Sechs effektive Alltagstipps. Deutsche Herzstiftung. https://herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/bluthochdruck/tipps-zu-blutdruck-natuerlich-senken
- Bryan, N. S., Tribble, G., & Angelov, N. (2017). Oral Microbiome and Nitric Oxide: The Missing Link in the Management of Blood Pressure. Current Hypertension Reports, 19(4), 33. https://doi.org/10.1007/s11906-017-0725-2