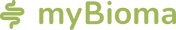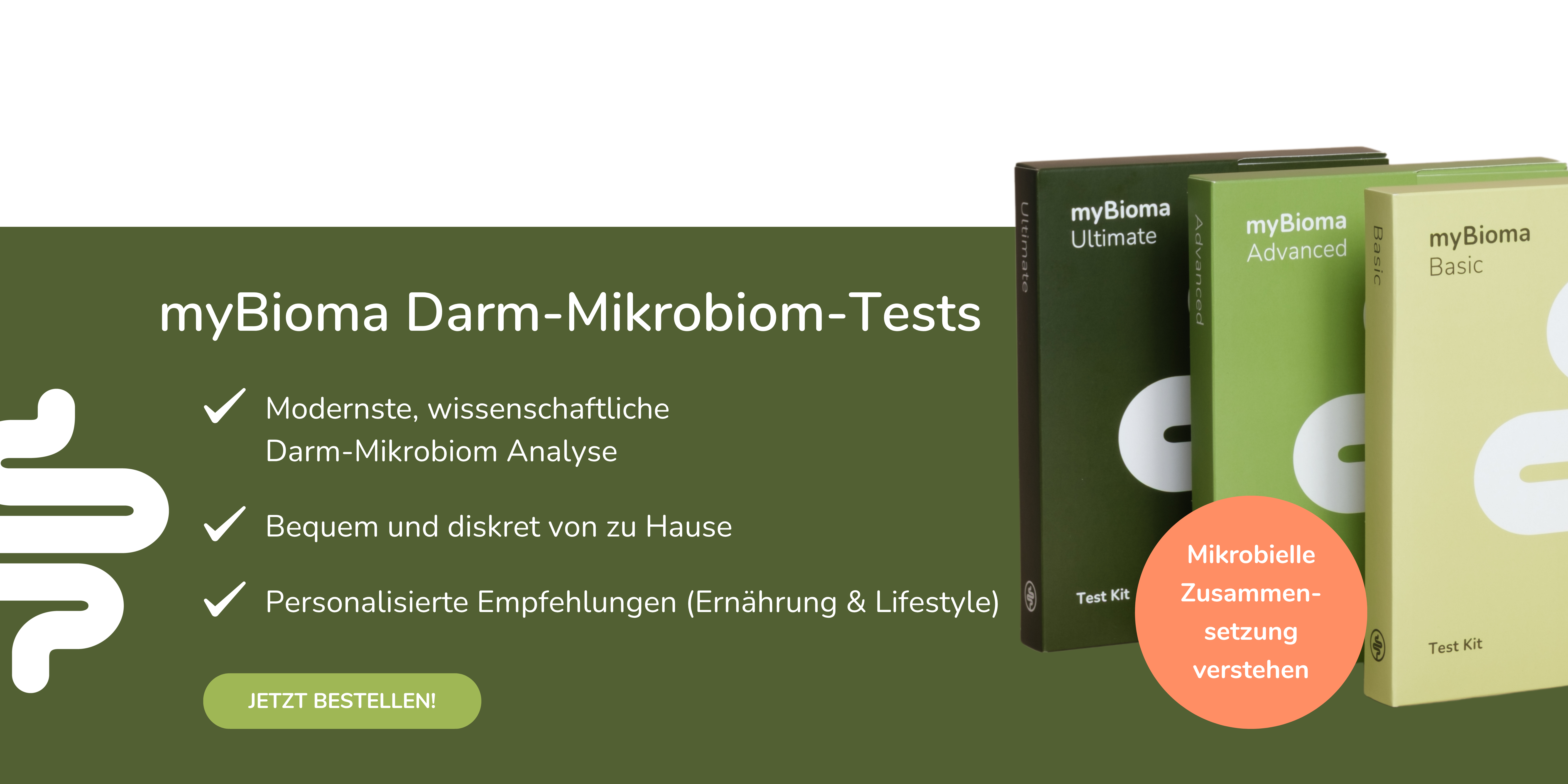Inhaltsverzeichnis
- Warum Protein für den Körper unverzichtbar ist
- Wie unser Darm Proteine verdaut
- Protein & Mikrobiom: Wichtige Zusammenhänge erklärt
- Tierisches vs. pflanzliches Protein – was ist besser?
- Die besten Proteinquellen
- Wie viel Protein brauchen wir?
- Wie viel Protein ist zu viel?
- Tipps für eine darmfreundliche Proteinzufuhr
- Proteintrends unter der Lupe
- Warum ein gesundes Mikrobiom bedeutend für den Muskelaufbau ist
- Fazit: Protein & Ballaststoffe sind ein Dream-Team für deinen Darm
Proteine sind wahre Multitalente: Sie halten uns satt, steuern unzählige Stoffwechselprozesse und liefern die Bausteine für Muskeln, Hormone, Enzyme und Immunzellen. Ohne ausreichend Protein würde unser Organismus nicht richtig funktionieren.
Während eine High-Protein-Ernährung besonders in der Fitnessszene beliebt ist, wird auch immer wieder vor den negativen Auswirkungen von zu viel Protein gewarnt. Um zu verstehen, wie Eiweiß wirkt, lohnt sich ein Blick in unseren Darm – genauer gesagt auf das Darm-Mikrobiom. Hier entscheidet sich, ob Protein uns stärkt oder im Übermaß belastet.
In diesem Artikel erfährst du unter anderem, wie Proteine verdaut werden, welchen Einfluss sie auf unser Mikrobiom haben und worauf du bei deiner Ernährung achten solltest, um nicht nur Muskelwachstum, sondern auch deine Darmgesundheit zu unterstützen.
Hinweis: „Eiweiß“ und „Protein“ meinen dasselbe. Der deutsche Begriff „Eiweiß“ stammt vom klaren, weißen Teil des Hühnereis (Eiklar), aus dem man früher Proteine kannte. „Protein“ ist der wissenschaftliche Ausdruck.
Warum Protein für den Körper unverzichtbar ist
Aminosäuren: Die Bausteine des Lebens
Proteine bestehen aus langen Ketten von Aminosäuren. Diese Bausteine spielen bei fast allen Prozessen in unserem Körper eine Rolle und übernehmen zentrale Aufgaben, unter anderem:
- Wundheilung: Proteine unterstützen die Neubildung von Gewebe und beschleunigen so die Regeneration nach Verletzungen oder Operationen.
- Immunabwehr: Antikörper und Immunzellen benötigen Protein, um unseren Körper zu schützen.
- Signalübertragung: Hormone wie Insulin oder Neurotransmitter wie Serotonin entstehen aus Aminosäuren. Sie steuern wichtige Abläufe im Stoffwechsel und Nervensystem.
- Energiequelle: Wenn Kohlenhydrate und Fette knapp sind, können Aminosäuren in Energie umgewandelt werden – wichtig in Stresssituationen oder beim Fasten.
- Transport & Speicherung: Proteine transportieren Nährstoffe im Blut, speichern Eisen (Ferritin) und binden Sauerstoff (Hämoglobin).
- Struktur & Stabilität: Kollagen und Keratin sind wichtige strukturgebende Proteine, die für gesunde Haut, Haare, Nägel, Knochen und Bindegewebe sorgen.
- Muskelaufbau & Regeneration: Ausreichend Protein ist grundlegend für den Aufbau und den Erhalt von Muskelmasse und wichtig für die Erholung nach dem Training.
- Darmgesundheit: Bestimmte Aminosäuren wie Glutamin dienen den Zellen der Darmschleimhaut als Energiequelle und unterstützen die Stabilität der Darmbarriere.
Proteine: Qualität vor Quantität
Manche Aminosäuren kann der Körper selbst herstellen. Andere – die sogenannten essentiellen Aminosäuren – müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Unterschiedliche Lebensmittel liefern unterschiedliche Aminosäuren in verschieden hohen Mengen. Um die Qualität eines Proteins zu bewerten, schaut man sich in erster Linie das Aminosäuremuster an: Man spricht von einem vollständigen Protein, wenn es alle 9 essentiellen Aminosäuren in ausreichender Menge enthält.
- Tierische Proteine (z. B. Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte) gelten in der Regel als vollständig, da sie ein optimales Aminosäurenprofil aufweisen und besonders gut vom Körper aufgenommen werden können.
- Pflanzliche Proteine (z. B. Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Getreide) gelten meist als unvollständig, da ihnen eine oder mehrere essentielle Aminosäuren in ausreichender Menge fehlen. Dennoch haben sie einige Vorteile: Sie liefern Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und wirken sich positiv auf die Darmflora aus.
- Kombinationen pflanzlicher Eiweißquellen (z.B. Bohnen mit Reis oder Hummus auf Vollkornbrot) ergänzen sich zu einem vollständigen Aminosäureprofil.
Auch die Bioverfügbarkeit, also wie gut unser Körper die Aminosäuren aufnehmen kann, ist entscheidend. Diese kann durch die Verarbeitung der Lebensmittel beeinflusst werden. Beispielsweise verändern Methoden wie Keimen oder Erhitzen die Proteinstruktur, wodurch die Aufnahme erleichtert wird. Zudem gibt es einige natürlich vorkommende Inhaltsstoffe, die dem Körper die Proteinverwertung erschweren und die Aufnahme hemmen. Dazu zählen beispielsweise Tannine, die in Getreide und Hülsenfrüchten vorkommen (1). Dazu aber später noch mehr.
Fazit: Eine ausgewogene Mischung aus tierischen und pflanzlichen Quellen deckt den Proteinbedarf und unterstützt gleichzeitig die Darmgesundheit.
Wie unser Darm Proteine verdaut
Damit unser Körper Proteine nutzen kann, müssen sie zuerst verdaut werden. Im Magen und Dünndarm werden Proteine von bestimmten Enzymen in kleinere Bruchstücke zerteilt: In Peptide und in ihr kleinste Form, die Aminosäuren. Der Großteil von diesen Bruchstücken, ungefähr 90%, wird bereits im Dünndarm in den Blutkreislauf aufgenommen.
Ein kleiner Rest bleibt unverdaut und gelangt in den Dickdarm. Dort stoßen die Proteinreste auf die Milliarden Bakterien unseres Darm-Mikrobioms. Und hier wird es spannend: Je nach Menge, Quelle und Begleitstoffen werden die Peptide und Aminosäuren von unseren Darmbakterien entweder zu nützlichen oder belastenden Stoffwechselprodukte umgewandelt (2).
Wissenswertes: Das Darm-Mikrobiom bezeichnet die Gemeinschaft unzähliger Mikroorganismen (vor allem Bakterien), die einen bedeutenden Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. Sie beeinflussen nicht nur Verdauung und Stoffwechsel, sondern unter anderem auch unser Immunsystem, unser psychisches Wohlbefinden und unsere Hautgesundheit.
Protein & Mikrobiom: Wichtige Zusammenhänge erklärt
Die Hauptnahrungsquelle unserer winzigen Darm-Mitbewohner sind eigentlich nicht Proteine, sondern Ballaststoffe. Diese werden von ihnen zu kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs) wie Butyrat, Acetat und Propionat umgewandelt, die zahlreiche positive Effekte auf unsere (Darm-)Gesundheit haben.
Auch aus Proteinen, beziehungsweise aus Stickstoff und Aminosäuren, können bestimmte Bakterien kurzkettige Fettsäuren und nützliche Stoffwechselprodukte zaubern. Allerdings können auch potenziell schädliche Stoffe entstehen. Das ist vor allem von der Art der Aminosäure und der Menge abhängig – aber auch von der Zusammensetzung des Mikrobioms, also den vorhandenen Bakterien im Darm.
Bestimmte Bakterien, wie beispielsweise Bifidobakterien und Laktobazillen, ernähren sich am liebsten von präbiotischen Ballaststoffen, die beispielsweise in Zwiebeln, Gerste, Bananen, abgekühlten Kartoffeln oder Spargel enthalten sind. Proteine werden hingegen eher von Bakterien wie Bacteroides und Clostridien verdaut. Man nennt diese Bakterien auch proteolytisch, also proteinabbauend.
Wenn wir zu viele Proteine und zu wenige Ballaststoffe aufnehmen, kann es passieren, dass diese proteinabbauenden Bakterien Überhand nehmen und andere, nützliche Bakterien verdrängen. Das feine Gleichgewicht im Mikrobiom gerät aus der Balance und es werden weniger entzündungshemmende, kurzkettige Fettsäuren produziert (2,3).
Kleiner Tipp am Rande: Jedes Bakterium hat seine Lieblingsspeise, weshalb wir uns am besten so abwechslungsreich wie möglich ernähren. So sorgen wir dafür, dass möglichst viele verschiedene Bakterien genährt werden und ihre unterschiedlichen Aufgaben bestmöglich für uns erledigen können.
Eine ausreichende Proteinaufnahme ist außerordentlich wichtig für die Darmgesundheit – zu viel Protein kann allerdings auch schaden.
Positive Effekte von Protein auf den Darm
- Energie für Darmzellen: Aminosäuren wie Glutamin und Aspartat sind Treibstoff für die Darmschleimhaut und unterstützen ihre Regeneration.
- Signalwirkung: Eiweißbausteine wirken wie Botenstoffe und helfen dem Verdauungstrakt, Nährstoffe „wahrzunehmen“ und die Verdauung optimal zu steuern.
- Baumaterial für Mikroben: Darmbakterien nutzen Aminosäuren nicht nur als Energiequelle, sondern auch zum Aufbau eigener Strukturen.
- Nützliche Stoffwechselprodukte: Bei ausgewogener Eiweißzufuhr können Stoffwechselprodukte wie bestimmte kurzkettige Fettsäuren entstehen, die unsere Darmschleimhaut stärken.
- Ballaststoff-Plus: Pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte liefern zusätzlich Ballaststoffe – eine Kombination, die beispielsweise Bifidobakterien und Roseburia fördert, beide bekannt für positive Effekte auf die Darmgesundheit (4).

Ausreichend Protein unterstützt nicht nur unsere körperliche Fitness, sondern auch unser Darm-Mikrobiom und unser Immunsystem.
Potenziell schädliche Effekte von Protein auf den Darm
Wird mehr Protein als nötig gegessen, gelangt der Überschuss unverdaut in den Dickdarm. Insbesondere Aminosäuren aus tierischen Proteinquellen, wie Methionin, Cystein, Tryptophan, Tyrosin oder Phenylalanin, können negative Auswirkungen auf unsere Darmgesundheit haben (2,4,5):
- Ungünstige Stoffwechselprodukte: Aus überschüssigem Protein entstehen im Dickdarm Ammoniak, Indole oder Schwefelverbindungen – diese können in hohen Mengen die Darmschleimhaut reizen und Verdauungsprobleme verursachen.
- Entzündungsrisiko: Solche Abbauprodukte schwächen die Darmbarriere und fördern somit entzündliche Prozesse.
- Mikrobielles Ungleichgewicht: Eiweißreiche, ballaststoffarme Ernährung kann zu einer reduzierten mikrobiellen Diversität und zu einem Ungleichgewicht der Darmbakterien führen.
- Langfristige Folgen: Ein dauerhaftes Übermaß an tierischem Protein, ohne Ausgleich durch Ballaststoffe, wird mit einem höheren Risiko für Darmerkrankungen und sogar Darmkrebs in Verbindung gebracht.
Tierisches vs. pflanzliches Protein – was ist besser?
Vorteile und mögliche Risiken von tierischen Proteinquellen
Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte sind tolle Eiweißlieferanten, da sie alle essentiellen Aminosäuren in optimalem Verhältnis liefern – das heißt, dass unser Körper sie ideal aufnehmen und verwerten kann.
Allerdings kann eine hohe Aufnahme von tierischem Protein zu problematischen, bakteriellen Stoffwechselprodukten führen und die Mikrobiom-Zusammensetzung negativ beeinflussen.
Auch andere Bestandteile von tierischen Proteinquellen (insbesondere von rotem oder verarbeitetem Fleisch), wie beispielsweise L-Carnitin und Cholin, können in großen Mengen negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Sie werden durch das Darm-Mikrobiom zu Trimethylamin (TMA) umgewandelt und anschließend in der Leber zu TMAO oxidiert. Dieses gelangt in den Blutkreislauf und steht in engem Zusammenhang mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko (2,6).

Wenn wir sehr viel tierisches Protein (vor allem aus rotem Fleisch) und gleichzeitig zu wenig Ballaststoffe essen, bilden bestimmte Darmbakterien verstärkt potenziell schädliche Stoffwechselprodukte.
Pflanzliche Proteine als Booster für die Darmgesundheit
Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Vollkornprodukte bringen gleich mehrere Vorteile:
- Sie enthalten Protein + Ballaststoffe und fördern somit die Produktion von wertvollen kurzkettigen Fettsäuren.
- Sie erhöhen die mikrobielle Diversität – einer der wichtigsten Marker für ein gesundes Mikrobiom.
- Sie liefern sekundäre Pflanzenstoffe, die zusätzlich entzündungshemmend wirken.
Verschiedene Studien legen nahe, dass pflanzliche Proteine die Darmgesundheit unterstützen können – vor allem aufgrund ihrer natürlichen Kombination mit Ballaststoffen und ihren antientzündlichen Eigenschaften (4).
Antinährstoffe in Pflanzen: Grund zur Sorge?
Sogenannte Antinährstoffe wie Phytinsäure, Oxalate oder Lektine kommen natürlicherweise in vielen pflanzlichen Proteinquellen wie Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen oder Samen vor. Sie können die Aufnahme bestimmter Mineralstoffe und die Eiweißverfügbarkeit etwas verringern. In der Regel ist das aber kein Problem, da sich die meisten dieser Stoffe durch Kochen deutlich reduzieren. Indem wir Hülsenfrüchte vor dem Kochen einweichen und Getreide keimen lassen oder Fermentation anwenden (zum Beispiel bei Tofu, Tempeh oder Sauerteigbrot), lassen sie sich noch effektiver reduzieren, sodass sie kaum noch Einfluss auf die Nährstoffverfügbarkeit haben. Spannend ist auch, dass einige Antinährstoffe in kleinen Mengen sogar positive Wirkungen haben können, zum Beispiel auf den Blutzucker- oder Cholesterinspiegel (7).
Dennoch empfehlen wir insbesondere Personen mit erhöhtem Proteinbedarf oder beispielsweise Eisenmangel, auch tierische Proteinquellen einzubeziehen. Durch einen abwechslungsreichen und ausgewogenen Speiseplan profitiert unser Körper auf allen Ebenen.
Fazit: Balance is key & Vielfalt gewinnt
Auch tierische Proteine haben Vorteile für unsere Darmgesundheit – zum Beispiel Milchprodukte, die probiotische Kulturen enthalten können. Entscheidend ist die Balance: eine Mischung aus hochwertigen tierischen und verschiedenen pflanzlichen Quellen, die zusätzlich Ballaststoffe mitbringen.
Die besten Proteinquellen
- Mageres Fleisch wie Hühner- und Putenbrust liefern hochwertiges Protein sowie wichtige Nährstoffe, beispielsweise Eisen und Zink.
- Fisch liefert nicht nur viel Protein, sondern häufig auch wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die gut für die Herzgesundheit sind. Achte unbedingt auf Qualität und nachhaltige Fischzucht.
- Milch und Milchprodukte wie Käse und Joghurt enthalten reichlich Protein, Kalzium und andere wichtige Nährstoffe. Zu den Spitzenreitern zählen fettarme Produkte wie Skyr, Hüttenkäse und Magerquark (oder wie wir in Österreich sagen: Topfen 😉)
- Eier enthalten alle essenziellen Aminosäuren und sind eine leicht verdauliche, vollständige Proteinquelle. Sie liefern zudem Vitamine, Mineralstoffe, gesunde Fette und Antioxidantien.
- Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen sind hervorragende Proteinquellen und liefern zusätzlich Ballaststoffe, Folsäure, Kalium, Eisen und Zink. Dank ihres hohen Lysingehalts ergänzen sie das Aminosäuremuster von Getreideprodukten ideal.
- Sojaprodukte wie Tofu, Tempeh und Sojadrinks enthalten alle essenziellen Aminosäuren und sind somit besonders hervorragende pflanzliche Proteinquellen, die sich zudem sehr vielfältig in die gesunde Küche integrieren lassen.
- Nüsse und Samen wie Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Erdnüsse, Chiasamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen und Erdnüsse (streng genommen zählen Erdnüsse zu den Hülsenfrüchten) sind kleine Kraftpakete, die dich mit Protein, gesunden Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Da Nüsse viele Kalorien und Fett enthalten, ist es sinnvoll, auf die Portionsgröße zu achten – wir empfehlen etwa 2-3 Esslöffel pro Tag.
- Quinoa und Amaranth sind pflanzliche Proteinquellen, die ebenfalls als vollständiges Protein gelten und zudem reich an Mineralstoffen und Ballaststoffen sind. Als sogenanntes Pseudogetreide sind sie zudem glutenfrei.

Pflanzliche Proteinquellen liefern nicht nur Eiweiß, sondern auch Ballaststoffe – und haben damit gleich einen doppelten gesundheitlichen Mehrwert.
Wie viel Protein brauchen wir?
Generell zeigen Verzehrsstudien, dass in Europa die meisten Menschen mehr als genug Protein aufnehmen – ein Mangel ist äußerst selten. Gefährdet sind Personen, die sehr einseitig oder zu restriktiv essen (extreme Diäten) oder unter bestimmten chronischen Erkrankungen leiden. Auch Vegetarier:innen und Veganer:innen sollten auf ihren Proteinkonsum achten - vor allem darauf, verschiedene pflanzliche Quellen über den Tag hinweg zu kombinieren.
Proteinbedarf von Erwachsenen
Die deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen eine Zufuhr von 0,8 g Protein pro kg Körpergewicht (8).
Beispiel: Bei einem Gewicht von 70 kg liegt der Bedarf bei 56 g Protein.
Das steckt zum Beispiel in:
- 60 g Haferflocken (trocken) → ca. 12 g Protein
- 200 g Kartoffeln + 100 g Topfen (Quark) → ca. 15 g Protein
- 150 g gekochte Linsen → ca. 13 g Protein
- 1 Ei → ca. 6 g Protein
- 2 Scheiben Vollkornbrot mit Hummus → ca. 10 g Protein
Alltagstipp für die Umsetzung: Indem man in jede Mahlzeit zumindest ein proteinreiches Lebensmittel integriert, ist der Bedarf ganz einfach zu decken – ohne umständliches tracken. Zum Beispiel: Joghurt und Haferflocken zum Frühstück, Tofu oder Hühnerbrust zu Mittag, Linsensuppe, Eier oder Hüttenkäse zur abendlichen Brotzeit.
Übrigens: Protein zu jeder Mahlzeit tut auch unserem Blutzucker gut! Mehr dazu erfährst du in diesem Blogartikel: Mikrobiom und Blutzucker – wie deine Darmbakterien deinen Blutzuckerspiegel beeinflussen
Bei chronischen oder akuten Erkrankungen, Entzündungen und Verletzungen kann der Proteinbedarf erhöht sein, da der Körper Unterstützung für Reperaturprozesse benötigt. Zudem kann sich der Proteinbedarf je nach Lebenssituation ändern:
Proteinbedarf von älteren Menschen, Sportler:innen und in der Schwangerschaft / Stillzeit
Bei bestimmten Personengruppen wird eine erhöhte Proteinzufuhr empfohlen (8):
Personen ab 65 Jahren
- Geschätzter Proteinbedarf: 1 – 1,2 g/kg Körpergewicht/Tag.
- Mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelmasse natürlicherweise ab (Sarkopenie) und das Risiko für Erkrankungen und Entzündungen steigt. Dadurch braucht der Körper vermehrt Proteine für die Reparatur von Gewebe, die Immunfunktion und Heilung. Hier handelt es sich nur um einen Schätzwert – bei vorhandenen Erkrankungen oder eingeschränkter Mobilität kann der Bedarf noch höher sein.
Sportler:innen
- Für Freizeitsportler*innen (4–5 × 30 Minuten/Woche, mittlere Intensität) reichen 0,8 g Protein/kg Körpergewicht pro Tag aus.
- Ambitionierte Breitensportler:innen oder Leistungssportler:innen (≥5 Stunden/Woche) profitieren von 1,2 - 2 g/kg Körpergewicht/Tag, angepasst an Sportart, Trainingsziel und -umfang.
- Proteine sollten über den Tag verteilt innerhalb der Mahlzeiten aufgenommen werden. Supplemente können eine praktische Ergänzung sein, sind jedoch nicht zwingend nötig und sollten auf keinen Fall eine ausgewogene Ernährung ersetzen.
Schwangerschaft und Stillzeit:
- Im zweiten Trimester steigt der Bedarf auf 0,9 g/kg Körpergewicht und im 3. Trimester auf 1 g/kg Körpergewicht.
- Stillende Frauen sollten etwa 1,2 g Protein / kg Körpergewicht aufnehmen.
Wie viel Protein ist zu viel?
Eine allgemein gültige Obergrenze für Protein gibt es bislang nicht. Das liegt daran, dass der individuelle Bedarf stark schwanken kann und die wissenschaftliche Daten bisher noch nicht eindeutig zeigen, ab welcher Menge Protein wirklich „zu viel“ ist.
Was man sicher weiß:
- Der Körper kann überschüssiges Protein nicht effizient verwerten (9).
- Beim Abbau entstehen Stoffwechselprodukte wie Harnstoff, die über den Urin ausgeschieden werden müssen. Deshalb ist bei sehr proteinreicher Ernährung auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig (10).
Einschätzungen von Fachgesellschaften (10):
- Beobachtungen zeigen, dass selbst eine drei- bis viermal höhere Proteinzufuhr als der Referenzwert über längere Zeiträume oft ohne erkennbare Nebenwirkungen möglich ist. Die WHO betont jedoch, dass daraus nicht automatisch folgt, dass solch hohe Mengen völlig risikofrei sind. Außerdem wurde der Einfluss auf das Mikrobiom (noch) nicht miteinbezogen.
- Die EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) sieht eine Zufuhr von bis zum Doppelten des Referenzwerts bei gesunden Erwachsenen als sicher an.
- Fazit für die Umsetzung: Für gesunde Erwachsene gelten bis zu 2 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht in der Regel als unproblematisch. Mengen darüber hinaus bringen nach aktuellem Forschungsstand keinen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen und sollten nicht dauerhaft konsumiert werden.
Symptome & Risiken bei zu viel Protein
Eine zu hohe Proteinzufuhr kann spürbare Symptome verursachen:
- Verdauungsbeschwerden: Blähungen, Durchfall oder Verstopfung durch verstärkte bakterielle Proteinfermentation.
- Mundgeruch: Abbauprodukte wie Ammoniak oder Ketonkörper können unangenehmen Mundgeruch verursachen.
- Dehydrierung: Mehr Harnstoffproduktion belastet die Nieren und erhöht den Flüssigkeitsbedarf – das kann sich beispielsweise in vermehrtem Durstgefühl, trockenem Mund oder Kopfweh zeigen.
- Hautbild: Insbesondere Molkenproteine der Kuhmilch mit ihren verzweigtkettigen Aminosäuren (engl. branched-chain-amino acids (BCAA)), regen die Talgdrüsen an und können somit Akne auslösen oder verstärken. Zudem können proteinabhängige Stoffwechselprodukte Entzündungen der Haut fördern.
- Langfristige Risiken: Nierensteine, erhöhte Leberwerte, Risiko für Darmkrebs und Herzkrankheiten wurden insbesondere bei einer Ernährung mit viel rotem oder verarbeitetem Fleisch festgestellt. Wichtig: Bei gesunden Menschen verkraften die Nieren hohe Proteinmengen meist problemlos. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion sollten aber vorsichtig sein.
Tipps für eine darmfreundliche Proteinzufuhr
- Pflanzliche Proteinquellen bevorzugen, um gleichzeitig wichtige Ballaststoffe aufzunehmen. Für eine bessere Verdaulichkeit empfiehlt es sich beispielsweise, Hülsenfrüchte vor dem Kochen über Nacht einzuweichen oder Getreidekörner keimen zu lassen.
- Proteinquellen mischen: z. B. Linsendal mit Reis, Hummus auf Vollkornbrot – für ein ausgewogenes Aminosäurenprofil.
- Qualität statt Quantität: Hochverarbeitete Lebensmittel meiden – viele Produkte, die mit High-Protein werben, beinhalten oft viele Zusatzstoffe oder Süßstoffe, die unserem Darm-Mikrobiom nicht gut tun.
- Ballaststoffe zu jeder Mahlzeit: Gemüse, Obst, Vollkorn und Hülsenfrüchte sorgen für Balance im Mikrobiom und liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe.
- Fermentierte Lebensmittel: Joghurt, Kefir oder Tempeh liefern Protein plus lebende Bakterien zur Unterstützung unseres Mikrobioms.
Proteintrends unter der Lupe
Ein klarer Ernährungstrend der letzten Jahre ist der steigende Konsum von High-Protein Produkten wie Proteinriegel, Proteinpudding, Proteinkaffee, Proteinpulver oder Proteinshakes.
Eine erhöhte Proteinzufuhr kann durchaus Vorteile haben – sie sorgt zum Beispiel für eine länger anhaltende Sättigung, unterstützt beim Abnehmen, hilft beim Muskelerhalt und fördert den Muskelaufbau im Training.
Mehr Protein bedeutet nicht automatisch mehr Muskeln: Überschüsse können vom Körper nicht unbegrenzt in Muskelmasse eingebaut werden. Stattdessen werden sie ausgeschieden, im Darm von Bakterien verstoffwechselt oder in Glukose und Fett umgewandelt. Diese Energie nutzt der Körper entweder direkt – oder sie wird als Fett gespeichert. Werden hochverarbeitete High-Protein-Produkte zur Basis der Ernährung, kann das negative Folgen für das Mikrobiom und die allgemeine Gesundheit haben.
Und auch der Geldbeutel kann darunter leiden: Viele Lebensmittelhersteller nutzen den High-Protein-Trend als Marketingstrategie und stellen aus kostengünstigen Zutaten hochverarbeitete Produkte her, die meist mehr kosten als die „normale“ Alternative.
Ab wann gelten Lebensmittel als High-Protein?
Laut EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) gelten folgende Vorgaben für Protein-Claims:
- „Proteinquelle“: Mindestens 12 % des gesamten Energiegehalts stammen aus Protein.
- „Eiweißreich“ / „High Protein“: Mindestens 20 % des gesamten Energiegehalts stammen aus Protein.
Beispielrechnung High Protein Pudding:
- Gesamtenergie: 80 kcal
- Proteingehalt: 10 g Protein × 4 kcal/g = 40 kcal aus Protein
- Proteinanteil: 40 ÷ 80 = 50 % → erfüllt die Bedingung „High Protein“
Wichtig: Immer einen Blick auf die Zutatenliste werfen. Die meisten High-Protein-Produkte beinhalten Zusatzstoffe wie Emulgatoren oder Süßstoffe, deren Auswirkungen auf das Mikrobiom noch nicht ausreichend erforscht und eher bedenklich anzusehen sind.
Proteinpulver – sinnvoll oder belastend?
Proteinpulver sind grundsätzlich eine praktische Möglichkeit, die tägliche Eiweißzufuhr zu erhöhen. Im Gegensatz zu proteinreichen Lebensmitteln fehlt ihnen jedoch meist die Vielfalt an Nährstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen, die für unsere Gesundheit so wichtig sind. Zudem enthalten viele Pulver Zusatzstoffen oder Süßungsmitteln oder sind mit Schadstoffen wie Schwermetallen belastet. Achte also unbedingt auf die Qualität!
Grundsätzlich lässt sich der Proteinbedarf mit einer ausgewogenen Ernährung bestens decken. In bestimmten Situationen können Proteinpulver eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Am häufigsten findet man Proteinsupplemente auf Milchproteinbasis:
- Molkenprotein (Whey): Schnelle Aufnahme, reich an essentiellen Aminsoäuren, bekannt für seine Vorteile für den Muskelaufbau
- Casein: Langsame Aufnahme über mehrere Stunden, ideal als „Nachtprotein“
Beide sind tierischen Ursprungs und nicht geeignet für Personen mit Laktoseintoleranz. Außerdem berichten manche Personen bei hoher Zufuhr von Verdauungsbeschwerden oder Hautproblemen.
Bei pflanzlichen Proteinpulvern empfiehlt es sich, verschiedene Quellen zu kombinieren. So ergänzt sich das Aminosäureprofil besser – denn mit Ausnahme von Soja haben pflanzliche Proteine eine geringere biologische Wertigkeit als tierische. Mögiche Quellen sind beispielsweise Lupinenprotein, Erbsenprotein, Sojaprotein, Hanfprotein oder Reisprotein – die Auswahl ist groß. Mögliche Nachteile sind teilweise der Geschmack (individuell), geringerer Proteingehalt pro 100g (dafür mehr Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe) und Allergiepotenzial (vor allem Soja).

Wenn du Proteinpulver nehmen möchtest, achte auf die Zutatenliste und entscheide dich für möglichst naturbelassene Proteinquellen ohne Zusatzstoffe und Süßungsmittel.
Problematisch: High Protein, Low Fibre
Bei vielen High-Protein-Diäten, wie beispielsweise bei der Keto-Diät, liegt der Fokus auf viel Fleisch, Milchprodukte und Eier. Kohlenhydrate werden gemieden – und somit ist auch die Aufnahme wertvoller Ballaststoffe (en: fibre) sehr gering. Ballaststoffe sind der Treibstoff für unser Mikrobiom und stehen in Verbindung mit einem geringeren Risiko für zahlreiche chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 oder bestimmten Krebsarten (11).
Studien zeigen, dass Bodybuilder, die zwar viel Eiweiß, aber wenig Ballaststoffe essen, eine weniger vielfältige Darmflora haben als solche, die genug Ballaststoffe aufnehmen. Eine geringe mikrobielle Diversität (Bakterien-Vielfalt) kann zu Verdauungsproblemen führen und langfristig gesehen vielfältige negative Folgen für die Gesundheit haben.
Gerade Sportler:innen, die Wert auf eine proteinreiche Ernährung legen, sollten daher unbedingt auf ausreichend Ballaststoffe achten. Die Empfehlungen der DGE liegen bei etwa 14 g Ballaststoffe pro 1000 kcal. Praktische Tipps für die Umsetzung findest du in diesem Blogartikel: Ballaststoffe: Gesundheitliche Wirkung und Tipps für eine ballaststoffreiche Ernährung
Tipp: Direkt vor oder nach dem Training kann eine ballaststoffreiche Mahlzeit Beschwerden auslösen, daher ist der Zeitpunkt der Ballaststoffaufnahme entscheidend.
Protein + Ballaststoffe für den Muskelaufbau
Wie weiter oben bereits erwähnt, werden Ballaststoffe im Darm von Bakterien zu kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs) wie Butyrat, Acetat und Propionat abgebaut. Diese Stoffe sind nicht nur wichtig für die Darmgesundheit, sondern stehen auch in Zusammenhang mit der Muskel- und Energieleistung. Tierstudien zeigen: Wenn zusätzlich Ballaststoffe gegeben wurden, verbesserten sich die Energiespeicher in den Muskeln, die Ausdauer stieg und Entzündungen nach dem Training gingen zurück. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass SCFAs auch direkt die Leistungsfähigkeit steigern können – etwa durch bessere Energiebereitstellung oder eine geringere Durchlässigkeit der Darmschleimhaut.
Auch beim Menschen gibt es erste Hinweise: In Studien mit Ausdauersportler:innen konnte eine gezielte Ballaststoffzufuhr die Zusammensetzung der Darmflora verbessern, entzündungshemmende Botenstoffe stabil halten und sogar Beschwerden wie Durchfall nach Belastung verringern. Das zeigt, wie eng Darm, Ernährung und Leistungsfähigkeit miteinander verbunden sind (12).
Warum ein gesundes Mikrobiom bedeutend für den Muskelaufbau ist
Man kann sich das Darm-Mikrobiom wie ein „Trainerteam“ für unsere Muskeln vorstellen. Darmbakterien entscheiden zwar nicht direkt, wie stark ein Muskel wächst, aber sie stellen die richtigen Werkzeuge und die Energie bereit, damit der Muskel seine Arbeit optimal machen kann. Indem die Bakterien Eiweißbausteine aufbereiten und nützliche Stoffwechselprodukte (wie kurzkettige Fettsäuren) liefern, helfen sie dem Körper, Protein besser zu verwerten. Wenn dich dieses Thema interessiert, wirf doch einen Blick in diesen Blogartikel: Wie hängen Mikrobiom und Sport zusammen?
Übrigens: Die myBioma Mikrobiom-Tests ermöglichen dir spannende Einblicke in die Zusammensetzung deines invdividuellen Mikrobioms. Der Mikrobiom-Test Ultimate zeigt dir durch den Parameter „körperliches Wohlbefinden" sogar, wie gut deine Darmbakterien deine Fitness unterstützen!
Fazit: Protein & Ballaststoffe sind ein Dream-Team für deinen Darm
Protein ist unverzichtbar für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit – doch mehr ist nicht immer besser.
- Zu wenig Protein → geschwächter Strukturstoffwechsel (Muskeln, Knochen, Haut, Bindegewebe), beeinträchtigter Hormonhaushalt, geschwächtes Immunsystem und reduzierte Unterstützung für die Darmschleimhaut.
- Zu viel Protein (ohne Ballaststoffe) → fördert toxische Stoffwechselprodukte im Darm.
- Verschiedene Proteinquellen + Ballaststoffe → Unterstützen unseren Körper, Strukturstoffwechsel, Immunsystem, Mikrobiom und Darmgesundheit.
Takeaway: Iss abwechslungsreich, kombiniere verschiedene Eiweißquellen (vor allem pflanzliche!) und vergiss nie die Ballaststoffe – dein Darm wird es dir danken.
Du möchtest Produkt-News als Erste*r erfahren und exklusive Rabatte, Rezepte und mehr erhalten? Dann werde jetzt Teil unseres HAPPY GUT CLUBs auf WhatsApp: myBioma Happy Gut Club
Für dich. Für deinen Darm.
Referenzen
- DGE. Ausgewählte Fragen und Antworten zu Protein und unentbehrlichen Aminosäuren. Verfügbar unter: http://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/faq/ausgewaehlte-fragen-und-antworten-zu-protein-und-unentbehrlichen-aminosaeuren/
- Bartlett A, Kleiner M. Dietary protein and the intestinal microbiota: An understudied relationship. iScience. 18. November 2022;25(11).
- Korpela K. Diet, Microbiota, and Metabolic Health: Trade-Off Between Saccharolytic and Proteolytic Fermentation. Annual Review of Food Science and Technology. 25. März 2018;9(Volume 9, 2018):65–84.
- Jia J, Dell’Olio A, Izquierdo-Sandoval D, Capuano E, Liu X, Duan X, u. a. Exploiting the interactions between plant proteins and gut microbiota to promote intestinal health. Trends in Food Science & Technology. 1. November 2024;153:104749.
- Alvarenga L, Kemp JA, Baptista BG, Ribeiro M, Lima LS, Mafra D. Production of Toxins by the Gut Microbiota: The Role of Dietary Protein. Curr Nutr Rep. Juni 2024;13(2):340–50.
- Di Rosa C, Di Francesco L, Spiezia C, Khazrai YM. Effects of Animal and Vegetable Proteins on Gut Microbiota in Subjects with Overweight or Obesity. Nutrients. Januar 2023;15(12):2675.
- Thakur A, Sharma V, Thakur A. An overview of anti-nutritional factors in food. International Journal of Chemical Studies. 2019;
- DGE. Protein Referenzwert. Verfügbar unter: http://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/protein/
- Delimaris I. Adverse Effects Associated with Protein Intake above the Recommended Dietary Allowance for Adults. ISRN Nutr. 18. Juli 2013;2013:126929.
- DGE. Protein. Verfügbar unter: http://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/faq/ausgewaehlte-fragen-und-antworten-zu-protein-und-unentbehrlichen-aminosaeuren/
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). 2021. Ausgewählte Fragen und Antworten zu Ballaststoffen. Verfügbar unter: http://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/faq/ausgewaehlte-fragen-und-antworten-zu-ballaststoffen/
- Hughes RL, Holscher HD. Fueling Gut Microbes: A Review of the Interaction between Diet, Exercise, and the Gut Microbiota in Athletes. Advances in Nutrition. 1. November 2021;12(6):2190–215.