Inhaltsverzeichnis
- So läuft der weibliche Zyklus natürlicherweise ab
- Wie wirkt die Antibabypille im Körper?
- Vor- und Nachteile der Pille im Überblick
- Wie Hormone das Darm-Mikrobiom beeinflussen
- Antibabypille und chronisch entzündliche Darmerkrankungen
- Die Verhütungspille und Reizdarm
- Der Einfluss der Pille auf das Vaginalmikrobiom
- Welche Alternativen gibt es zur hormonellen Verhütung?
- Worauf solltest du bei der Wahl der Pille achten?
- So unterstützt du deinen Körper während der Pilleneinnahme
- Fazit: Was du mitnehmen solltest
Das Darm-Mikrobiom steht in enger Wechselwirkung mit vielen Organen und Körperfunktionen. Es beeinflusst nicht nur die Verdauung, sondern auch das Immunsystem, die Hormonregulation und sogar die Stimmung. Umgekehrt hat auch das Hormonsystem einen Einfluss auf den Darm. Da weltweit Millionen Frauen hormonelle Verhütungsmittel wie die Antibabypille einnehmen, stellt sich die Frage: Wie beeinflusst die Pille unser Mikrobiom – und was bedeutet das für die Darmgesundheit?
So läuft der weibliche Zyklus natürlicherweise ab
Der weibliche Zyklus dauert im Durchschnitt 28 Tage und gliedert sich grob in drei Phasen:
-
Menstruationsphase (Tag 1–5): Die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen – die Periode beginnt.
-
Follikelphase (Tag 1–14): In den Eierstöcken reift eine Eizelle heran, unter dem Einfluss von Östrogen baut sich die Gebärmutterschleimhaut wieder auf.
-
Ovulation und Lutealphase (Tag 14–28): Um den 14. Tag findet der Eisprung statt. Danach produziert der Körper vermehrt Progesteron, das die Schleimhaut auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet. Bleibt diese aus, sinken die Hormonspiegel – der Zyklus beginnt von vorn.
Wie wirkt die Antibabypille im Körper?
Die Antibabypille enthält synthetische Hormone – meist eine Kombination aus Östrogen und Gestagen (künstliches Progesteron) – und greift gezielt in den natürlichen Zyklus ein. Sie verhindert den Eisprung, verdickt den Schleim im Gebärmutterhals und verändert die Gebärmutterschleimhaut, sodass sich keine befruchtete Eizelle einnisten kann.
Dabei gaukelt sie dem Körper konstant hohe Hormonspiegel vor, wodurch die natürlichen Schwankungen von Östrogen und Progesteron ausbleiben. Der gesamte hormonelle Zyklus wird künstlich unterdrückt. Die monatliche Blutung unter der Pille ist somit auch keine echte Periode, sondern eine Abbruchblutung, die durch das Pausieren der Hormonzufuhr entsteht (1).
Schematische Darstellung des Hormonverlaufs im weiblichen Zyklus – mit und ohne Einnahme einer (Kombi-)Pille.
Unterschiede - Minipille vs. Kombipille
Grundsätzlich wird zwischen der Kombipille und der Minipille unterschieden – beide Varianten sind in zahlreichen Ausführungen und Marken erhältlich, die sich in ihrer Zusammensetzung und Wirkweise leicht unterscheiden können (2):
-
Kombinierte Pille: Enthält Östrogen und Gestagen. Sie unterdrückt zuverlässig den Eisprung, verändert die Gebärmutterschleimhaut und macht den Zervixschleim undurchlässig für Spermien. Kombipillen werden meist 21 Tage lang eingenommen, gefolgt von einer 7-tägigen Pause oder Einnahme hormonfreier Pillen – in dieser Zeit tritt eine sogenannte Abbruchblutung auf.
-
Minipille: Enthält ausschließlich Gestagen. Sie unterdrückt den Eisprung nicht immer zuverlässig, wirkt jedoch durch eine Verdickung des Zervixschleims und eine Veränderung der Gebärmutterschleimhaut empfängnisverhütend. Minipillen werden ohne Pause durchgehend eingenommen.
Vor- und Nachteile der Pille im Überblick
Die Einnahme oraler Verhütungsmethoden kann sowohl Vorteile als auch mögliche Nebenwirkungen mit sich bringen. Wichtig ist: Jeder Körper reagiert anders – wie gut die Pille vertragen wird, ist sehr individuell und lässt sich nicht pauschal vorhersagen (1,3):
Vorteile:
- Sehr sichere Verhütungsmethode
- Geringere Menstruationsbeschwerden
- Zyklusregulierung
- Therapie bei Endometriose und beim Prämenstruellen Syndrom (PMS)
- Hautbildverbesserung bei Akne und Hirsutismus (übermäßig starke Körperbehaarung bei Frauen)
- Reduziertes Risiko für Eierstock- und Endometriumkarzinom
- Unterdrückung funktioneller Ovarialzysten
Mögliche Risiken:
- Kein Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen
- Erhöhtes Risiko für Thrombosen, Schlaganfall und Herzinfarkt
- Nebenwirkungen wie Brustspannen, Übelkeit, Kopfschmerzen
- Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen
- Störungen der Libido und sexuelle Funktionsstörungen
- Erhöhtes Risiko für Brust- und Zervixkarzinom
- Potenzielle Beeinflussung der Stimmung, depressive Symptome
- Möglicher Einfluss auf Darmgesundheit und Immunsystem (z. B. Autoimmunerkrankungen)
Die Pille und ihre Auswirkungen auf unser Gehirn
Orale Verhütungsmittel werden von über 100 Millionen Frauen weltweit genutzt und unterdrücken die körpereigene Produktion von Hormonen wie Progesteron um bis zu 97 %. Da Hormonschwankungen während des Menstruationszyklus, der Schwangerschaft oder Menopause das Gehirn stark beeinflussen, ist es naheliegend, dass auch die hormonelle Verhütung Auswirkungen auf das Gehirn hat. Besonders kritisch ist, dass viele Frauen bereits im Jugendalter mit hormoneller Verhütung beginnen - also in einer Phase, in der sich das Gehirn noch in seiner Entwicklung befindet. Dennoch fehlen bislang fundierte Studien, die die langfristigen Auswirkungen auf Stimmung, Denkfähigkeit und Gehirnstruktur ausreichend untersuchen (4).

Die in der Pille enthaltenen Hormone können sich auf den Darm auswirken.
Wie Hormone das Darm-Mikrobiom beeinflussen
Das Mikrobiom besteht aus Milliarden Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen, die in enger Symbiose mit dem menschlichen Organismus leben. Sie helfen bei der Verdauung, stärken das Immunsystem, produzieren Vitamine und beeinflussen sogar das zentrale Nervensystem (Darm-Hirn-Achse).
Hormone spielen in dieser komplexen Mikrobiom-Welt eine regulierende Rolle. Auch die Hormone Östrogen sowie Gestagene - die in oralen Verhütungsmitteln zum Einsatz kommen - zeigen einen Einfluss auf die Darmflora. Beispielsweise sind die beiden Hormone in der Lage, bestimmte Bakterienarten gezielt zu fördern oder zu hemmen. Dadurch kann die Einnahme der Pille indirekt zu Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobioms führen – ein Prozess, der langfristig gesundheitliche Folgen haben kann. Umgekehrt beeinflussen jedoch auch die im Darm vorhandenen Bakterien, wie Hormone matabolisiert, recyclet oder abgebaut werden. Am Beispiel vom Östrogen: Es gibt eine spezielle Gruppe von Mikroben, die am Östrogenstoffwechsel beteiligt sind. Dieses sogenannte Östrobolom kann Östrogene produzieren und beeinflusst, wie diese im Körper wirken. Damit hat dein Mikrobiom auch ein Wörtchen mitzureden, wie die Pille bei dir wirkt und zu einem gewissen Teil auch, wie gut du sie verträgst (5,6).
Was zeigen Studien zur Pille und Darmflora?
Medikamente werden meist nicht explizit auf ihre Auswirkungen auf die Darmflora getestet. So sind auch die Auswirkungen der Pille auf das Darm-Mikrobiom bisher noch wenig erforscht.
Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass bei Frauen, die eine Antibabypille einnehmen, bestimmte Darmbakterien häufiger vorkommen als bei Nicht-Nutzerinnen. Dazu zählen unter anderem Lachnospiraceae, Barnesiella und Faecalibacterium. Trotz dieser Unterschiede in der Zusammensetzung ließ sich insgesamt keine signifikante Veränderung in der bakteriellen Vielfalt zwischen beiden Gruppen feststellen. Allerdings zeigte sich bei den Frauen mit Pille am 21. Tag des Zyklus ein Rückgang der Artenvielfalt. Das deutet darauf hin, dass sich die Darmflora bei diesen Frauen im Verlauf des Zyklus leicht verändert, vermutlich durch den hormonellen Einfluss der Pille. Diese Veränderungen müssen nicht zwangsläufig negativ sein, machen aber deutlich, dass die hormonelle Steuerung durch die Pille auch die mikrobiologische Besiedelung des Darms beeinflussen kann.
Weitere Studien stehen dazu im Gegensatz und beschreiben eine Abnahme der Bakterienvielfalt durch die Einnahme der Antibabypille. Besonders eine Langzeitstudie weist auf eine abnehmende Alpha-Diversität im Zeitverlauf hin (1).
Dieser wichtige Bereich der Wissenschaft benötigt noch weitere Studien, um genaue Aussagen zur Auswirkung der Pille auf das Darm-Mikrobiom treffen zu können. Besonders kontrollierte Studien, mit einer hohen Teilnehmerinnenzahl sowie Langzeitstudien sind begrenzt.
Neugierig, wie es deinem Darm wirklich geht? Die myBioma Darm-Mikrobiom-Tests geben dir spannende Einblicke in dein Mikrobiom.
Weitere Informationen zu Anwendung, Auswertung und Tipps für deine Darmgesundheit findest du auf unserer Website: https://mybioma.com/
Der Einfluss der Pille auf die Verdauung
Die Einnahme der Pille kann sich indirekt auf die Verdauung auswirken, da sie den natürlichen Hormonhaushalt verändert – und dieser steht in enger Verbindung zur Darmfunktion. Viele Frauen berichten im Zusammenhang mit der Pille über verstärkte Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Verstopfung oder Bauchschmerzen.
Ein möglicher Grund dafür sind die erhöhten Spiegel von Östrogen und Progesteron, die unter anderem die Darmbewegung verlangsamen können. Dies kann zu einem Völlegefühl, Druck im Bauch oder eben zu Verstopfung und Blähungen führen (7).
Verändert die Pille zudem das empfindliche Gleichgewicht der Darmflora, kann sich das ebenfalls spürbar auf die Verdauung auswirken. Einige Darmbakterien produzieren Methan oder Wasserstoff. Das ist völlig normal und auch wichtig - wenn diese Bakterien aber beispielsweise durch eine Pilleneinnahme überhand nehmen, können Verdauungsprobleme entstehen (1).
Dies ist besonders zu beobachten bei Frauen mit vorbestehenden Magen-Darm-Beschwerden oder funktionellen Störungen des Verdauungstraktes. Hier kann die Einnahme der Pille vermehrt zur Entstehung solcher Symptome führen oder diese verstärken.

Die Pille und das Darm-Mikrobiom beeinflussen sich gegenseitig.
Antibabypille und chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Östrogen kann die Schutzfunktion der Darmschleimhaut schwächen, wodurch vermehrt Entzündungen entstehen können – ähnlich wie bei einem Leaky-Gut, wo ebenfalls die Darmschleimhaut durchlässiger wird und entzündliche Prozesse auftreten. Studien zeigen, dass Frauen, die längerfristig Kombipillen (mit Östrogen und Gestagen) nehmen, ein höheres Risiko für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen haben - besonders wenn eine genetische Veranlagung vorliegt. Bei reinen Gestagenpillen (Minipillen) ist das Risiko für Colitis ulcerosa dagegen kaum erhöht. Wie genau Hormonart, Dosis und Einnahmedauer zusammenhängen, ist aber noch nicht ausreichend erforscht (8).
Die Verhütungspille und Reizdarm
Ob orale Verhütungsmittel wie die Kombi- oder Minipille das Risiko für das Reizdarmsyndrom erhöhen, ist wissenschaftlich bislang nicht eindeutig geklärt. Die Entstehung eines Reizdarms gilt als multifaktoriell – also durch viele verschiedene, zum Teil noch nicht vollständig verstandene Ursachen bedingt. Auch hormonelle Einflüsse spielen dabei eine Rolle. Nach aktuellem Wissensstand führt die Einnahme der Pille jedoch allein nicht zur Entstehung eines Reizdarms (9).
Auffällig ist allerdings: Frauen sind fast doppelt so häufig vom Reizdarmsyndrom betroffen wie Männer. Eine mögliche Erklärung dafür sind die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron, die unter anderem die Darmbewegung beeinflussen. Da viele Pillen genau diese Hormone enthalten, könnte sich die Einnahme auf typische Reizdarmbeschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Blähungen oder Krämpfe auswirken – sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Einige Frauen berichten unter der Pille von einer Besserung ihrer Symptome, andere empfinden sie als verstärkt. Besonders Präparate, die ohne Pause eingenommen werden (meist Minipillen), scheinen bei manchen Betroffenen eine Linderung zu bewirken (10).
Doch kann auch umgekehrt ein Reizdarm die Wirkung der Pille beeinträchtigen? In seltenen Fällen ja: Da die Pille über den Verdauungstrakt aufgenommen wird, kann starker Durchfall – insbesondere innerhalb von zwei bis drei Stunden nach der Einnahme – die Aufnahme stören. Dadurch kann der Empfängnisschutz möglicherweise nicht vollständig gegeben sein.
Der Einfluss der Pille auf das Vaginalmikrobiom
Nicht nur das Darm-Mikrobiom kann durch die Pilleneinnahme verändert werden, auch auf das vaginale Mikrobiom zeigt das orale Verhütungsmittel einen Einfluss: Die Scheidenflora wird primär von Laktobazillen dominiert, die ein saures Milieu erzeugen und so vor pathogenen Keimen schützen. Die Einnahme der Pille kann diese Schutzfunktion unterstützen – allerdings zeigen Studien auch, dass bestimmte Pillenarten zu einer Abnahme der wichtigen Laktobazillen führen und das Risiko für bakterielle Vaginose und Pilzinfektionen erhöhen kann (11, 12).
Hier kommt wieder unser Darm ins Spiel: Durch ein intaktes Darm-Mikrobiom kann die Scheidenflora gestärkt und das Risiko für eine bakterielle Vaginose gesenkt werden. Wie das funktioniert? Die bakterielle Vaginose ist meist mit einem Mangel an schützenden Laktobazillen in der Scheide verbunden. Interessanterweise dient der Darm als eine Art Speicher für diese nützlichen Bakterien. Über das sogenannte Östrobolom – die Darmbakterien, die am Östrogenstoffwechsel beteiligt sind – können Laktobazillen vom Darm in den Intimbereich gelangen und dort das Gleichgewicht unterstützen. Studien zeigen: Wer gezielt die Laktobazillen im Darm fördert, kann auch seine vaginale Gesundheit positiv beeinflussen (13).

Neben hormonellen Verhütungsmethoden gibt es auch verschiedenste Verhütungsmittel, die ohne Hormone auskommen.
Welche Alternativen gibt es zur hormonellen Verhütung?
Nicht jede Verhütungsmethode muss in den Hormonhaushalt eingreifen – es gibt eine Reihe wirksamer, nicht-hormoneller Alternativen, die je nach Lebenssituation und Bedürfnissen in Frage kommen (14):
Sterilisation (dauerhaft)
Eine Sterilisation kann sowohl bei der Frau als auch beim Mann durchgeführt werden. Bei Frauen werden die Eileiter durchtrennt, sodass keine Eizelle mehr in die Gebärmutter gelangen kann. Bei Männern wird bei einer Vasektomie die Samenleiter durchtrennt, sodass keine Spermien mehr in den Samenerguss gelangen können.
→ Diese Eingriffe sind sehr sicher, aber meist dauerhaft und schwer rückgängig zu machen.
Kupferspirale (langfristig)
Die Kupferspirale wird in die Gebärmutter eingesetzt. Das darin enthaltene Kupfer sorgt dafür, dass sich Spermien schlechter bewegen können und somit die Befruchtung verhindert wird. Die Spirale hält zwischen 5 und 10 Jahren und kann bei Bedarf jederzeit wieder entfernt werden.
→ Die Kupferspirale ist sehr zuverlässig, kann aber die Regelblutung verstärken.
Barrieremethoden
Kondome bieten nicht nur Schutz vor einer Schwangerschaft, sondern helfen auch dabei, sexuell übertragbare Krankheiten zu vermeiden. Das Diaphragma oder die Portiokappe sitzen als schützende Barriere über dem Muttermund und werden oft zusammen mit einem Spermizid verwendet – einem Wirkstoff, der Spermien abwehrt oder bewegungsunfähig macht.
→ Barrieremethoden sind nur bei korrekter Anwendung wirklich sicher, schützen jedoch auch vor übertragbaren Krankheiten.
Chemische Mittel
Spermizide, die meist als Cremes angewendet werden, verhindern, dass sich Spermien bewegen oder wirken einfach abtötend. Das Phexxi-Gel sorgt dafür, dass sich der pH-Wert in der Scheide verändert, sodass das Umfeld für Spermien weniger einladend ist und sie sich schlechter fortbewegen können.
→ Diese Mittel werden meist nur in Kombination mit weiteren Verhütungsmethoden eingesetzt, da ihre Sicherheit begrenzt ist.
Natürliche Methoden
Bei natürlichen Verhütungsmethoden, wie etwa der Temperaturmethode, wird der eigene Zyklus genau beobachtet, um fruchtbare und unfruchtbare Tage besser zu erkennen. So lässt sich der Geschlechtsverkehr gezielt planen oder vermeiden, um eine Schwangerschaft auf natürliche Weise zu verhindern.
→ Natürliche Methoden erfordern etwas Übung und sind relativ aufwendig, bieten aber eine Verhütung ohne Hormone oder Hilfsmittel.
Worauf solltest du bei der Wahl der Pille achten?
Es gibt verschiedene Präparate, die jeweils eine leicht unterschiedliche Hormonzusammensetzung haben. Welche Pille für dich die richtige ist, hängt vor allem von drei Faktoren ab: deinem Gesundheitszustand, wie gut du die Einnahme regelmäßig schaffst und ob du eine Verhütung suchst, die langfristig wirkt (2). Lass dich am besten von deiner Frauenärztin / deinem Frauenarzt dazu beraten.
1. Passt die Pille zu deinem Gesundheitsprofil?
Nicht alle Pillen sind für jede Frau gleich gut geeignet. Kombinationspillen (mit Östrogen und Gestagen) solltest du meiden, wenn du z. B.:
-
über 35 bist und rauchst
-
unter Bluthochdruck, Migräne mit Aura oder Thrombosen leidest
-
Herzprobleme oder starkes Übergewicht hast
-
gerade stillst (innerhalb der ersten 6 Wochen nach Geburt)
In solchen Fällen ist eine reine Gestagenpille (Minipille) besser geeignet – sie kommt ohne Östrogen aus und ist meist verträglicher (2).
2. Hast du Beschwerden, die durch die Pille gelindert werden könnten?
Bei bestimmten Beschwerden kann eine Kombipille manchmal vorteilhaft sein. Das Östrogen kann helfen, den Hormonhaushalt zu stabilisieren und Symptome zu mildern. Bei den folgenden Beschwerden kann die Kombipille die bessere Wahl sein (2):
-
schmerzhaften Regelblutungen
-
PMS
-
Akne
-
PCOS
-
Endometriose
3. Wie zuverlässig kannst du die Einnahme einhalten?
Die tägliche Einnahmezeit ist je nach Pille entscheidend für die Wirksamkeit:
-
Minipillen: hier ist die Einnahmezeit sehr strikt (oft ±3 Stunden)
-
Kombinationspillen: am flexibelsten – bis zu 24 Stunden verspätete Einnahme ist meist noch unproblematisch
Wenn du Schwierigkeiten hast, täglich zur gleichen Zeit an die Einnahme zu denken, kann eine Kombipille (sofern medizinisch geeignet) oder ein langfristigeres Verhütungsmittel (z. B. Hormonpflaster, Ring, Spirale) praktischer sein (2).

Gegenüberstellung der beiden Pillenarten in Bezug auf ihre Risiken, Einnahme und Anwendung.
So unterstützt du deinen Körper während der Pilleneinnahme
Die Einnahme oraler Verhütungsmittel kann eine zusätzliche Belastung für deinen Körper darstellen sowie die Aufnahme wichtiger Nährstoffe etwas hemmen – umso wichtiger ist es, ihn in dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen und mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen (15):
1. B-Vitamine
Die Pille kann die Blutspiegel von Folat, B6 und B12 senken – deshalb ist es besonders wichtig, auf eine ausreichende Aufnahme dieser Vitamine zu achten. Sie sind unter anderem wichtig für die Zellteilung, Nerven- und Hormongesundheit.
➡️ Lebensmittel: grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Avocado, Vollkorn, Eier
2. Magnesium & Zink
Diese beiden Mineralien sind für über 600 Körperfunktionen nötig – inkl. Energiegewinnung, Nervenfunktionen und Immunsystem. Durch die Pilleneinnahme entsteht ein erhöhter Bedarf an Magnesium und Zink.
➡️ Quellen: Nüsse, Linsen, Fleisch, Meeresfrüchte, grünes Gemüse
3. Vitamin D
Die Pille kann den Vitamin-D-Stoffwechsel negativ beeinflussen und eine Unterversorgung fördern. Achte daher besonders auf ausreichend Vitamin D.
➡️ Quellen: fetter Fisch, Eigelb, Sonne, ggf. Supplemente
4. Antioxidantien
Die Pille kann oxidativen Stress im Körper erhöhen und somit einen negativen Einfluss auf die Gesundheit deiner Zellen haben. Achte daher besonders auf eine ausreichende Zufuhr an Vitamin C, E und sekundären Pflanzenstoffen wie Polyphenole.
➡️ Fokus: Obst, Beeren, Gemüse, Nüsse, Grüntee
5. Flüssigkeit & Bewegung
Hormone wie Östrogen und Progesteron beeinflussen den Wasser- und Salzhaushalt im Körper. Dadurch kann es zu Wassereinlagerungen kommen. Ausreichend trinken (etwa 2–2,5 Liter pro Tag) und regelmäßige Bewegung unterstützen den Körper dabei, Flüssigkeit und Elektrolyte besser zu regulieren und Schwellungen vorzubeugen.
6. Darmunterstützende Kost
Um Verdauungsbeschwerden vorzubeugen und deinen Darm während der Einnahme der Antibabypille unterstützen zu können, achte auf eine ausreichende Zufuhr von prä- und probiotischen Lebensmitteln sowie eine abwechslungsreiche, vielfältige Ernährung.
➡️ Quellen: Haferflocken, Lauch, Chicorée, Joghurt, Sauerkraut, Kefir

So kannst du deinen Körper während einer Pilleneinnahme unterstützen.
Fazit: Was du mitnehmen solltest
Die Antibabypille wirkt nicht nur auf den Hormonhaushalt – sie beeinflusst auch andere Bereiche des Körpers, darunter das Mikrobiom und den Stoffwechsel.
Für viele Frauen ist sie eine zuverlässige und praktische Verhütungsmethode, steht jedoch in den letzten Jahren durch ihre potenziell negativen Auswirkungen auf die Gesundheit auch vermehrt in der Kritik. Ob Pille oder nicht, ist eine absolut individuelle Entscheidung und sollte ärztlich abgeklärt sein. In jedem Fall lohnt es sich aber, mögliche Auswirkungen auf die ganzheitliche Gesundheit im Blick zu behalten und seinen Körper - im Falle einer regelmäßigen Einnahme - bestmöglichst zu unterstützen.
Eine ausgewogene Ernährung, eine gezielte Nährstoffzufuhr, eine gute Darmgesundheit sowie ein bewusster Umgang mit dem eigenen Körper können helfen, potenzielle Nebenwirkungen abzufangen und das Wohlbefinden zu unterstützen. 🧡
Referenzen
- Terrazas, F., Kelley, S. T., DeMasi, T., Giltvedt, K., Tsang, M., Nannini, K., Kern, M., & Hooshmand, S. (2025). Influence of menstrual cycle and oral contraception on taxonomic composition and gas production in the gut microbiome. Journal of Medical Microbiology, 74(3). https://doi.org/10.1099/jmm.0.001987
- Dr Brenda, Ikeji. (2025, Juni 14). What is the Best Contraceptive Pill for Me? https://www.zavamed.com/uk/best-contraceptive-pill.html
- Barbara Bartlinka & Geovanni Espinosa. (2018). Integrative Sexual Health (1. Aufl.). Oxford University Press.
- Taylor, C. M., Pritschet, L., & Jacobs, E. G. (2021). The scientific body of knowledge – Whose body does it serve? A spotlight on oral contraceptives and women’s health factors in neuroimaging. Frontiers in Neuroendocrinology, 60, 100874. https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2020.100874
- Hua, X., Cao, Y., Morgan, D. M., Miller, K., Chin, S. M., Bellavance, D., & Khalili, H. (2022). Longitudinal analysis of the impact of oral contraceptive use on the gut microbiome. Journal of Medical Microbiology, 71(4). https://doi.org/10.1099/jmm.0.001512
- d’Afflitto, M., Upadhyaya, A., Green, A., & Peiris, M. (2022). Association Between Sex Hormone Levels and Gut Microbiota Composition and Diversity—A Systematic Review. Journal of Clinical Gastroenterology, 56(5), 384–392. https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001676
- Judkins, T. C., Dennis-Wall, J. C., Sims, S. M., Colee, J., & Langkamp-Henken, B. (2020). Stool frequency and form and gastrointestinal symptoms differ by day of the menstrual cycle in healthy adult women taking oral contraceptives: a prospective observational study. BMC women's health, 20(1), 136. https://doi.org/10.1186/s12905-020-01000-x
- Pasvol, T. J., Bloom, S., Segal, A. W., Rait, G., & Horsfall, L. (2022). Use of contraceptives and risk of inflammatory bowel disease: A nested case–control study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 55(3), 318–326. https://doi.org/10.1111/apt.16647
- Kimberly Malone Crossley. (2024). Birth control and IBS: everything you need to know. The Lowdown. Health hub. https://thelowdown.com/blog/ibs-and-the-pill
- Sharon Liao. (2023). Do Your Hormones Affect IBS? WebMD. https://www.webmd.com/ibs/hormones-ibs
- Krog, M. C., Hugerth, L. W., Fransson, E., Bashir, Z., Nyboe Andersen, A., Edfeldt, G., Engstrand, L., Schuppe-Koistinen, I., & Nielsen, H. S. (2022). The healthy female microbiome across body sites: Effect of hormonal contraceptives and the menstrual cycle. Human Reproduction, 37(7), 1525–1543. https://doi.org/10.1093/humrep/deac094
- Bakus, C., Budge, K. L., Feigenblum, N., Figueroa, M., & Francis, A. P. (2023). The impact of contraceptives on the vaginal microbiome in the non-pregnant state. Frontiers in Microbiomes, 1, 1055472. https://doi.org/10.3389/frmbi.2022.1055472
- Siddiqui R, Makhlouf Z, Alharbi AM, Alfahemi H, Khan NA. (2022). The Gut Microbiome and Female Health.Biology;11(11):1683.
- Howard, S. A., & Benhabbour, S. R. (2023). Non-Hormonal Contraception. Journal of Clinical Medicine, 12(14), 4791. https://doi.org/10.3390/jcm12144791
- Laura Kunces, PhD, RD, CSSD. (2025). Best Supplements While on the Birth Control Pill. THORNE online.

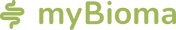

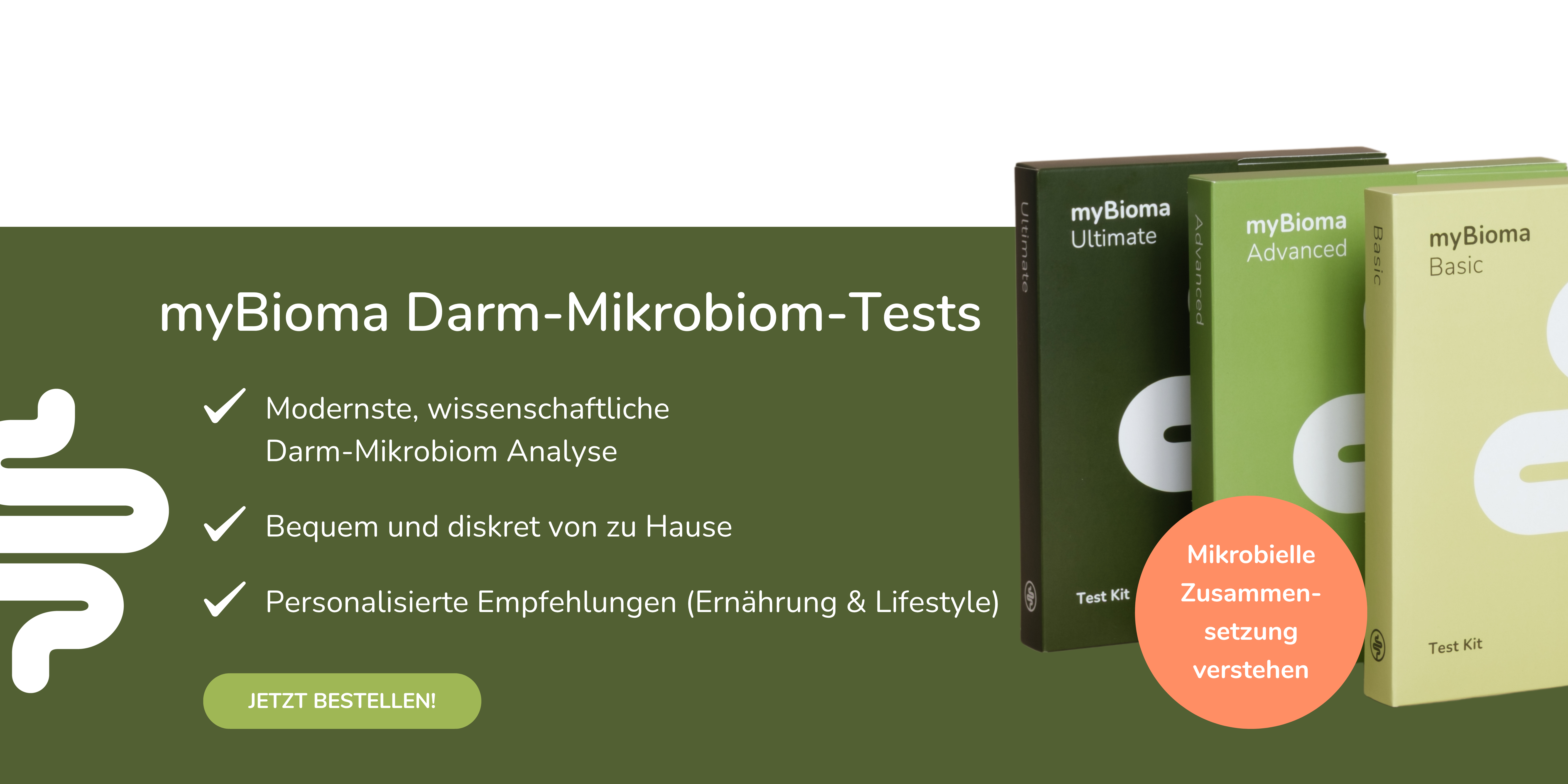
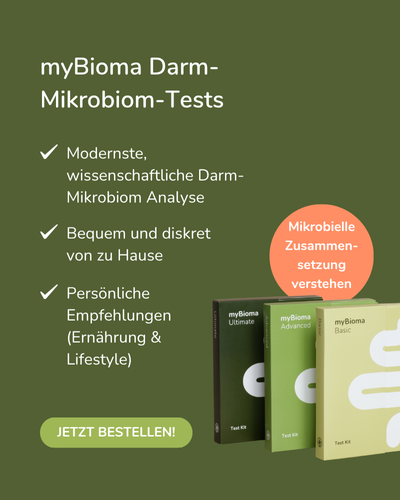



2 comentarios
Hallo Mona,
vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag und dass du deine Erfahrungen mit uns teilst! Es ist unglaublich spannend, welchen Einfluss Hormone auf die Verdauung und den Darm haben können.
Alles Liebe,
Evelyn von myBioma
Danke für den Beitrag.
Ich hatte kmmer einen „schnellen“ Darm doch ab 39 formte sich das auf töglich 3-4x mit starken Blähungen. Es wurde immer schlimmer. Daneben wirden die PMDS Symtome stärker. Seit ich die Slinda (Gestagen) nehme und nun weiss das meine Östrogendominanz, welche auch Perimneopausal kommen kann, dafür verantwortlich war, habe ich ein neues Leben & einen neuen Darm.
Und dank eurer Analyse weiss ich auch wie gut es meinem Darm geht.