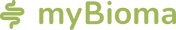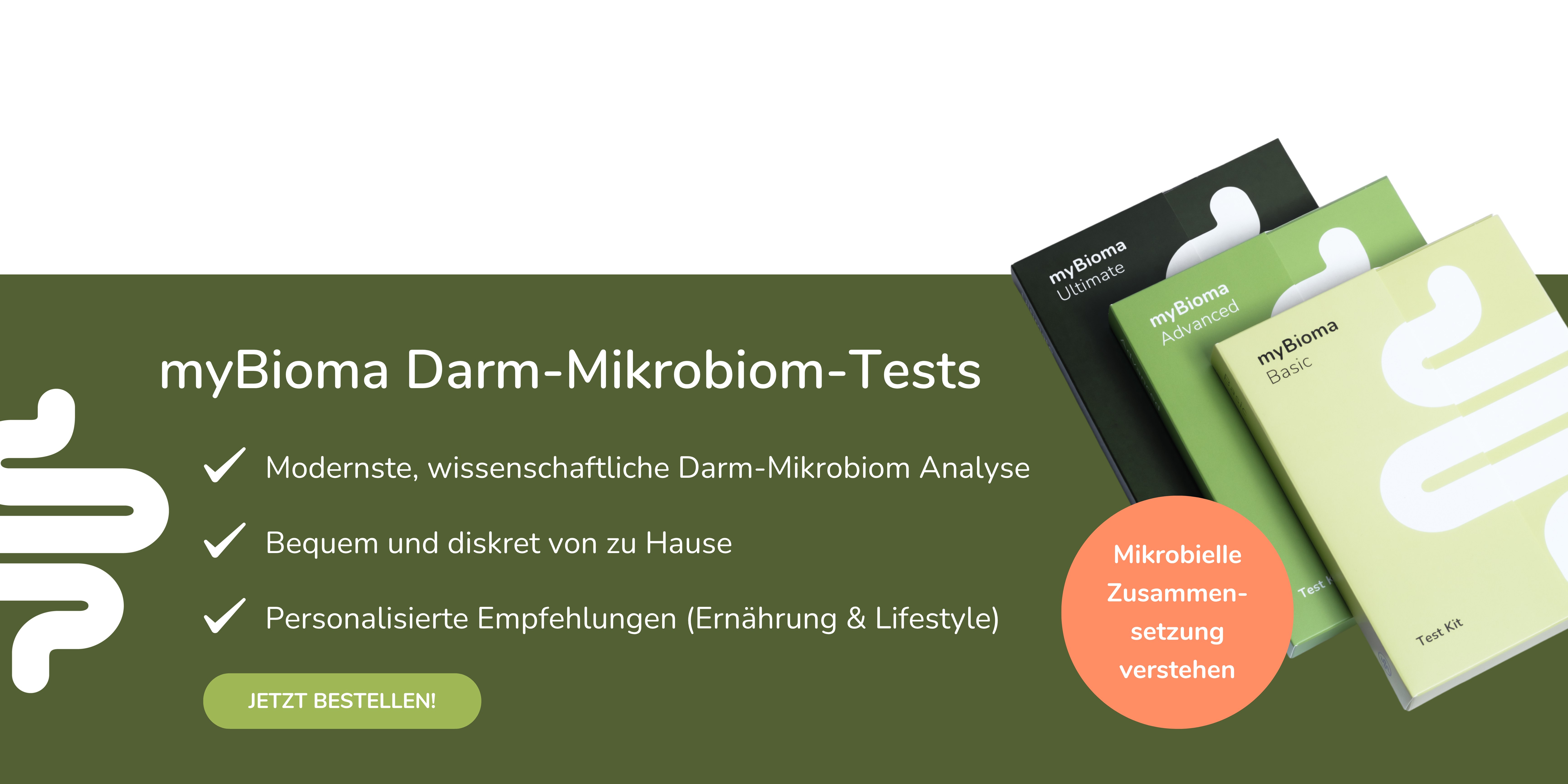Inhaltsverzeichnis
- Wie der Körper den Blutzucker normalerweise reguliert
- Wenn die Blutzuckerregulation gestört ist
- Wie das Mikrobiom den Blutzucker beeinflussen kann
- Prä- und Probiotika zur Blutzuckerregulation: Potenzial mit Grenzen
- Mikrobiom stärken & Blutzucker stabil halten – so geht's im Alltag
- Mythen und Fakten zum Thema Blutzuckerregulierung
- Fazit: Der Darm als Schlüssel zur Glukosekontrolle
Bis vor wenigen Jahren war der Darm vor allem für seine Rolle in der Verdauung bekannt. Heute weiß man: Der Darm ist weit mehr als ein reines „Nahrungsverwertungsorgan“. Er ist Heimat von Billionen Mikroorganismen – unser Darm-Mikrobiom. Dieses fein abgestimmte Ökosystem aus Bakterien, Viren, Pilzen und Archaeen beeinflusst weitreichende Prozesse in unserem Körper – von der Immunabwehr bis hin zur Regulation des Blutzuckerspiegels.
Angesichts der weltweiten Zunahme von Typ-2-Diabetes (T2DM) rückt ein Aspekt zunehmend ins Zentrum der Forschung: die Frage, wie das Mikrobiom unsere Stoffwechselgesundheit mitsteuert – und ob wir es gezielt beeinflussen können.
Wie der Körper den Blutzucker normalerweise reguliert
Kohlenhydrate sind der wichtigste Energielieferant des Körpers und haben einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Sie stecken vor allem in Lebensmitteln wie Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Obst, aber auch in Süßigkeiten und zuckerhaltigen Getränken. Nach dem Verzehr werden sie im Verdauungstrakt in ihre Zuckerbausteine - vor allem Glukose - abgebaut und im Dünndarm ins Blut aufgenommen. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel an. Die Bauchspeicheldrüse reagiert darauf, indem sie Insulin ausschüttet – ein Hormon, das den Zucker in die Körperzellen einschleust, vor allem in Muskeln und Leber. Dort wird die Glukose entweder direkt zur Energiegewinnung genutzt oder als Glykogen (die Speicherform der Glukose) gespeichert. In der Folge sinkt der Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Niveau. Dieser fein abgestimmte Prozess läuft bei gesunden Menschen mehrmals täglich ab – meist, ohne dass wir es bemerken (1).
Neben Kohlenhydraten können auch Eiweiße – besonders bei einer kohlenhydratarmen Ernährung – den Blutzucker leicht erhöhen. Fette hingegen wirken nicht direkt auf den Blutzucker, können aber die Magenentleerung verlangsamen und so den Anstieg des Blutzuckers verzögern oder abmildern.

Schematische Darstellung: So funktioniert die Blutzuckerregulation in einem gesunden Körper.
Verschiedene Lebensmittel lassen den Blutzucker sehr unterschiedlich stark ansteigen. Das hängt unter anderem ab von:
- dem Glykämischen Index (GI) – ein Maß dafür, wie schnell ein Lebensmittel den Blutzucker ansteigen lässt. Lebensmittel mit einem hohen GI lassen den Blutzucker schneller ansteigen, als Lebensmittel mit einem niedrigen GI
- dem Ballaststoffgehalt – Ballaststoffe verlangsamen die Glukoseaufnahme
- dem Verarbeitungsgrad – stark verarbeitete Lebensmittel führen oft zu rascheren Blutzuckeranstiegen
- dem Fett- und Eiweißanteil – diese verzögern die Aufnahme von Kohlenhydraten
- der Kombination mit anderen Lebensmitteln – etwa wenn Fett oder Säure (z. B. Essig) die Magenentleerung verlangsamen
Diese Faktoren können bestimmen, ob der Blutzucker schnell, stark oder moderat ansteigt – und damit auch, wie viel Insulin benötigt wird. Ein langfristig häufig erhöhter Insulinbedarf kann zur Insulinresistenz beitragen – und damit zum Risiko für Typ-2-Diabetes.
Wenn die Blutzuckerregulation gestört ist
Bei einer gestörten Blutzuckerregulation – insbesondere bei Typ-2-Diabetes – funktioniert das fein abgestimmte Zusammenspiel von Insulinausschüttung und Glukoseaufnahme nicht mehr richtig. Die Körperzellen reagieren weniger empfindlich auf Insulin. Dadurch wird Glukose nicht mehr so schnell in die Zellen aufgenommen und bleibt vermehrt im Blut – man spricht dann von einer Insulinresistenz. Obwohl die Bauchspeicheldrüse zunächst versucht, durch mehr Insulin gegenzusteuern, reichen die Mengen irgendwann nicht mehr aus, um den Blutzucker in den Normalbereich zu bringen. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) ist die Folge (1).
Eine schlechte Blutzuckerregulation kann langfristige Schäden an Gefäßen, Nerven und Organen verursachen – z. B. an Augen, Nieren oder dem Herz-Kreislauf-System.
Ursachen für eine Insulinresistenz und erhöhten Blutzucker
Mehrere Faktoren können die Entwicklung einer Insulinresistenz und eines erhöhten Blutzuckers begünstigen (2):
- Ungünstige Ernährung: Stark verarbeitete, zuckerreiche und ballaststoffarme Lebensmittel fördern hohe Blutzuckerspitzen und damit eine erhöhte Insulinausschüttung.
- Bewegungsmangel: Ohne körperliche Aktivität sinkt die Aufnahmefähigkeit der Muskelzellen für Glukose.
- Adipositas: Vor allem viszerales Bauchfett produziert entzündungsfördernde Botenstoffe, die die Insulinwirkung hemmen.
- Chronische Entzündungen: Fördern die Insulinresistenz auf molekularer Ebene.
- Genetische Veranlagung: Beeinflusst die individuelle Anfälligkeit für Insulinresistenz.
- Schlafmangel und chronischer Stress: Beeinflussen hormonelle Regelkreise (z. B. Cortisol) und fördern metabolische Störungen.

Dein Darm-Mikrobiom und deine Darmgesundheit können sich auf deine Blutzuckerwerte auswirken.
Wie das Mikrobiom den Blutzucker beeinflussen kann
Zahlreiche Studien zeigen, dass sich die Zusammensetzung des Mikrobioms bei Menschen mit Typ-2-Diabetes oder einer gestörten Blutzuckerregulation deutlich von der gesunder Personen unterscheidet. Eine geringere Diversität (=Vielfalt) und das Fehlen bestimmter förderlicher Bakterienarten scheinen zur Entwicklung einer Insulinresistenz beitragen zu können (3).
Zentrale Mechanismen für den Einfluss des Mikrobioms auf den Blutzucker sind:
Entzündungen und Insulinresistenz
Eine gestörte Zusammensetzung der Darmflora kann dazu führen, dass mikrobielle Bestandteile in die Blutbahn gelangen. Diese Bestandteile können chronische, sogenannte „low-grade“ oder "stille" Entzündungen auslösen, die wiederum die Insulinrezeptoren hemmen und so eine Insulinresistenz fördern. So können mikrobielle Veränderungen im Darm Entzündungen im ganzen Körper auslösen. Diese Entzündungen stören dann die Insulinwirkung im Körper (4).
Produktion kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs)
Butyrat, Propionat und Acetat sind kurzkettige Fettsäuren, die beim Abbau von Ballaststoffen durch bestimmte Darmbakterien entstehen. Sie gelten als entzündungshemmend, stärken die Darmbarriere und verbessern die Insulinsensitivität (5). Wenn über die Ernährung zu wenig Ballaststoffe aufgenommen werden und es an SCFA-produzierenden Bakterien fehlt, kann das dazu führen, dass zu wenige kurzkettige Fettsäuren produziert werden.
Besonders relevante SCFA-produzierende Bakterien sind Faecalibacterium prausnitzii und Bifidobacterium – beide sind bei Menschen mit Typ-2-Diabetes oft vermindert (3).
Hormonelle Regulation über Inkretine
Das Mikrobiom beeinflusst die Ausschüttung sogenannter Inkretine- Hormone, die die Blutzuckerkontrolle verbessern. Die wichtigsten sind:
- GLP-1 (Glucagon-like peptide-1)
- GIP (Gastric inhibitory peptide)
Beide fördern die Insulinfreisetzung, hemmen Glukagon (= Hormon, das den Blutzucker ansteigen lässt) und verzögern die Magenentleerung (6).
Bestimmte Darmbakterien – z. B. Akkermansia muciniphila – regen direkt die GLP-1-Ausschüttung an. Andere wirken sich indirekt, etwa über kurzkettige Fettsäuren oder weitere Ausscheidungsprodukte auf die Hormonausschüttung aus (7,4).
Verdauungsbeschwerden und Blutzucker
Verdauungsprobleme wie Verstopfung, Blähungen oder ein Reizdarmsyndrom werden häufig isoliert betrachtet – dabei können sie ein Hinweis auf ein unausgeglichenes Darm-Mikrobiom sein. Das kann stille Entzündungen fördern, den Stresspegel erhöhen und so indirekt die Blutzuckerregulation aus dem Gleichgewicht bringen.
Chronische Beschwerden im Verdauungstrakt setzen den Körper unter Druck – sie erhöhen den Cortisolspiegel, was wiederum die Glukosefreisetzung in der Leber stimulieren kann. Die Folge: Auch ohne „Zuckerschub“ von außen kann der Blutzucker ansteigen.
Neben all diesen soeben genannten Aspekten spielen auch mikrobielle Abbauprodukte wie veränderte Gallensäuren und verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) eine Rolle in der Blutzuckerregulation (5).
 Die Blutzuckerreaktion auf ein Lebensmittel kann von Person zu Person stark variieren: Während der Verzehr eines Donuts bei der einen Person zu einer deutlichen Blutzuckerspitze führt, kann es bei einer anderen nur zu einem kleinen Blutzucker-Anstieg führen.
Die Blutzuckerreaktion auf ein Lebensmittel kann von Person zu Person stark variieren: Während der Verzehr eines Donuts bei der einen Person zu einer deutlichen Blutzuckerspitze führt, kann es bei einer anderen nur zu einem kleinen Blutzucker-Anstieg führen.
Personalisierte Glukoseantworten
Spannenderweise können Glukoseantworten auf ein bestimmtes Lebensmittel oder eine Mahlzeit bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich ausfallen. Auch das Mikrobiom könnte hierbei eine Rolle spielen (7): Die aufgenommene Nahrung muss im Verdauungstrakt zunächst in ihre Bestandteile zerlegt werden, bevor Nährstoffe – wie Glukose – ins Blut aufgenommen werden können. Dabei wirken neben körpereigenen Verdauungsenzymen auch Darmbakterien mit. Verschiedene Bakterienarten sind auf den Abbau bestimmter Nährstoffe spezialisiert. Je nach individueller Zusammensetzung des Mikrobioms kann dieser Abbau unterschiedlich effizient oder schnell ablaufen – was wiederum beeinflussen kann, wie rasch und stark der Blutzuckerspiegel nach dem Essen ansteigt.
Neben dem, was wir essen, können auch viele weitere Faktoren den Anstieg des Blutzuckers beeinflussen. Unter anderem (8):
Flüssigkeitszufuhr: Trinken wir über den Tag verteilt zu wenig Wasser, kann dies den Blutzuckerspiegel negativ beeinflussen.
Tageszeit: Der Blutzucker kann im Tagesverlauf natürlicherweise schwanken.Der Blutzucker schwankt im Tagesverlauf auf natürliche Weise.
Schlafmangel: Zu wenig Schlaf beeinträchtigt die Insulinempfindlichkeit. 7–9 Stunden Schlaf pro Nacht können zur Stabilisierung des Blutzuckers beitragen.
Stress & Krankheit: Psychischer Stress oder akute Erkrankungen können den Blutzucker deutlich ansteigen lassen.
Menstruation: Hormonelle Veränderungen im Verlauf des Menstruationszyklus können den Blutzucker beeinflussen.
Fu et al. (2025) weisen darauf hin, dass genau diese individuellen Unterschiede die Grenzen klassischer Ernährungsempfehlungen aufzeigen und personalisierte Ansätze künftig wichtiger machen (7).
Wechselwirkung zwischen Blutzucker und Mikrobiom
Zwischen dem Mikrobiom und dem Blutzucker besteht eine wechselseitige Beziehung: Nicht nur beeinflusst das Mikrobiom den Blutzuckerspiegel, auch umgekehrt kann dieser die Zusammensetzung der Darmflora verändern. Eine schlechte Glukosekontrolle kann so das Mikrobiom langfristig schädigen – und umgekehrt (4). Zudem kann auch die Einnahme von antidiabetischen Medikamenten oder ein bestehendes Übergewicht bzw. Adipositas zu Veränderungen in der mikrobiellen Zusammensetzung führen (3).
Die Ursachen-Wirkungs-Beziehung ist in diesem Forschungsfeld noch nicht vollständig geklärt und es bedarf weiterer Forschung, um die Mechanismen des Mikrobioms auf den Blutzucker allumfassend zu verstehen.
Was wir beeinflussen können: Lebensstil & Ernährung
Aktuell wird eine gezielte Modulation des Mikrobioms selten bis gar nicht als Therapie zur Senkung des Blutzuckers eingesetzt.
Klar ist jedoch: eine gesunde, ballaststoffreiche Ernährung mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten kann nachweislich die Vielfalt und Stabilität des Mikrobioms fördern – und so indirekt den Zuckerstoffwechsel verbessern (3). Auch körperliche Bewegung wirkt sich positiv auf die bakterielle Zusammensetzung im Darm aus.
Ein ganzheitlicher Ansatz ist hier jedoch erforderlich, denn das Mikrobiom kann durch verschiedenste Aspekte wie die Einnahme von Medikamenten, Stress, Alter oder genetische Faktoren beeinflusst werden (4).

Dein Darm-Mikrobiom wird von vielfältigen Faktoren beeinflusst.
Prä- und Probiotika zur Blutzuckerregulation: Potenzial mit Grenzen
Vor dem Hintergrund der wachsenden Erkenntnisse zur Rolle des Mikrobioms stellt sich die Frage, ob sich die Blutzuckerregulation gezielt über Prä- und Probiotika stärken lässt. Präbiotika sind spezielle Ballaststoffarten, die unseren nützlichen Darmbakterien als Futter dienen. Ihre regelmäßige Aufnahme kann das Wachstum von SCFA-produzierenden Bakterien wie Bifidobacterium oder Faecalibacterium fördern und somit indirekt die Insulinsensitivität verbessern (3). Probiotika hingegen sind lebende Mikroorganismen, die in fermentierten Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind und das Gleichgewicht der Darmflora positiv beeinflussen können.
Vielversprechende Tier- und erste Humanstudien zeigen, dass die Einnahme bestimmter Probiotika – etwa Akkermansia muciniphila oder Bifidobacterium longum – mit einer verbesserten Glukoseverwertung und geringeren Entzündungswerten assoziiert sind und somit eine antidiabetische Wirkung entfalten können (6,7).
Trotz dieser positiven Signale ist Vorsicht geboten: Die Effekte sind stark individuell unterschiedlich und langfristige klinische Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit in Bezug auf die Blutzuckerregulation fehlen weitgehend. Es besteht also noch Forschungsbedarf, bevor Probiotika als gezielte Maßnahme zur Blutzuckerregulierung empfohlen werden können (4,6).
Mikrobiom stärken & Blutzucker stabil halten – so geht's im Alltag
1. Makronährstoffe kombinieren
Versuche in deinen Mahlzeiten neben Kohlenhydraten auch immer Proteine (z.B. Hülsenfrüchte, Tofu, Eier, mageres Fleisch) und Fette (z.B. Olivenöl, Nüsse und Samen, Avocado) einzubauen. Das verlangsamt die Magenentleerung und sorgt für einen weniger schnellen Blutzuckeranstieg.
2. Ballaststoffe einbauen
Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte (Vollkornnudeln, Naturreis, Vollkornbrötchen), Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse und Samen verlangsamen die Zuckeraufnahme und fördern die Darmgesundheit.
3. Komplexe Kohlenhydrate bevorzugen
Komplexe Kohlenhydrate benötigen mehr Verdauungsarbeit und werden so auch weniger schnell in den Blutkreislauf aufgenommen. Das verhindert schnelle Blutzuckerspitzen. Leckere komplexe Kohlenhydrate sind beispielsweise: Hafer (ganzes Korn), Gerste, Grünkern, Hülsenfrüchte, Hirse, Buchweizen, Quinoa und Vollkornreis.
4. Bewegung nach dem Essen
Ein Spaziergang (schon 10 Minuten!) nach dem Essen hilft dem Körper, Zucker direkt in die Muskeln zu transportieren und unterstützt so deine Blutzuckerregulation.
5. Süßes clever genießen
Versuche Süßigkeiten nicht auf leeren Magen zu essen. Für eine abgeschwächte Blutzuckerreaktion esse deine Leckerei im Anschluss einer Mahlzeit oder kombiniere sie mit Eiweiß oder Fett (z. B. Gummibärchen mit Nüssen oder einen Keks mit Skyr), um Blutzuckerspitzen abzufedern.
6. Geregelte Mahlzeiten
Lange Fastenphasen oder ständiges snacken können deinen Blutzucker durcheinanderbringen. Regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten helfen deinem Blutzucker-Gleichgewicht.

Rund um das Thema Blutzuckerregulation gibt es viele Meinungen und Behauptungen – wir haben einige davon unter die Lupe genommen und decken auf: Handelt es sich um einen Mythos oder einen Fakt?
Mythen und Fakten zum Thema Blutzuckerregulierung
Der Einfluss unserer Lebensmittelwahl oder unseres Lebensstils auf den Blutzucker wird auf Social Media stark thematisiert. Bei der Vielzahl an Meinungen und Informationen zu diesem Thema fällt es oft schwer, den Überblick zu behalten – vor allem, wenn es um wissenschaftlich fundierte Aussagen geht.
Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir einige gängige Behauptungen überprüft und sie als „Fakt“ oder „Mythos“ entlarvt.
⚠️ Mythos! Obst ist schlecht für den Blutzucker.
So pauschalisiert ist diese Aussage falsch. Frisches Obst als reine „Zuckerquelle“ anzusehen und es deshalb zu meiden ist nicht der richtige Ansatz – denn anders als bei Zuckern aus Süßigkeiten liefert Obst wertvolle Nährstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe und sollte in angemessener Mengen Platz in jeder ausgewogenen Ernährung finden (9).
Und ja: Obst kann einen etwas höheren Blutzuckeranstieg hervorrufen – wichtig zu verstehen ist jedoch, dass nicht jeder Blutzuckeranstieg per se etwas Schlechtes ist. Die Blutzuckerregulation ist ein absolut normaler Prozess im Körper, vor dem man keine Angst haben sollte. Fazit ist: die gesundheitlichen Vorteile von frischen Früchten übersteigen das Risiko einer etwas erhöhten Blutzuckerantwort.
Um deine Blutzuckerregulation zu unterstützen, kannst du dein frisches Obst gemeinsam mit Fetten oder Proteinen aufnehmen (z. B. Apfel + Nüsse).
Problematischer sind eher Fruchtsäfte oder Smoothies – sie enthalten kaum Ballaststoffe, oft weniger Vitamine als frisches Obst und liefern meist deutlich größere Mengen an Fruchtzucker. Denn in einem Glas Saft oder Smoothie stecken oft mehrere Früchte – viel mehr, als man normalerweise auf einmal essen würde.
Das führt dazu, dass der Körper auf einmal eine unnatürlich hohe Zuckermenge aufnimmt. Durch die flüssige Form gelangen diese Zucker zudem besonders schnell ins Blut – was Blutzuckerspitzen begünstigen kann.
✅ Fakt! Schlaf, Stress & Bewegung beeinflussen den Blutzucker stark.
Wie bereits weiter oben kurz erwähnt: Die Blutzuckerregulation ist keine reine Ernährungsfrage – auch Schlafqualität, Stresslevel und körperliche Aktivität spielen eine zentrale Rolle. Bereits wenige Nächte mit schlechtem Schlaf können die Insulinsensitivität verschlechtern. Stress führt zu einem Anstieg von Cortisol – das regt die Glukosefreisetzung aus der Leber an, ganz unabhängig vom Essen.
Bewegung hingegen wirkt unmittelbar positiv: Schon ein kurzer Spaziergang nach dem Essen kann helfen, den Blutzucker zu senken und eine größere Muskelmasse trägt zu einer besseren Blutzuckerregulation bei (8).
Deine Blutzuckerbalance lässt sich also auch unabhängig von deiner Ernährung durch deinen Lebensstil beeinflussen.
⚠️ Mythos! Low-Carb ist der einzige Weg zur Blutzuckerkontrolle.
Low-Carb-Diäten haben sich einen festen Platz in der Diskussion rund um Blutzuckerregulation erobert – und ja, eine reduzierte Kohlenhydratzufuhr kann kurzfristig dabei helfen, Blutzuckerspitzen abzufangen. Doch daraus zu schließen, dass Low-Carb der einzig sinnvolle oder gesunde Weg sei, greift zu kurz.
Viel wichtiger als die reine Menge ist die Qualität der Kohlenhydrate. Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, stärkehaltiges Gemüse oder Pseudogetreide wie Quinoa liefern nicht nur komplexe, langsam verdauliche Kohlenhydrate – sondern auch eine Vielzahl an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen.
Gerade die Ballaststoffe spielen eine Schlüsselrolle in der Blutzuckerregulation: Sie verlangsamen die Glukoseaufnahme, sorgen für eine sanftere Glukosekurve nach dem Essen, fördern das Sättigungsgefühl und unterstützen ganz nebenbei die Darmgesundheit. Besonders wirksam sind lösliche Ballaststoffe – z. B. aus Hafer, Flohsamenschalen, Leinsamen oder Hülsenfrüchten (10). Eine einseitige, ballaststoffarme Ernährung kann langfristig zu Verdauungsbeschwerden oder einem unausgewogenen Mikrobiom führen.
✅ Fakt! Essensreihenfolge beeinflusst den Blutzucker.
Nicht nur was, sondern auch in welcher Reihenfolge du etwas isst, kann den Blutzuckerverlauf beeinflussen. Studien zeigen: Wer zuerst ballaststoffreiche Lebensmittel (z. B. Salat oder Gemüse), dann Eiweiß oder Fett und zuletzt Kohlenhydrate isst, sorgt für einen deutlich flacheren Anstieg der Glukosekurve.
Der Grund: Diese Reihenfolge verlangsamt die Magenentleerung, sorgt für einen langsameren Blutzuckeranstieg und verbessert die Insulinantwort. Besonders gut wirkt dieser Trick bei Menschen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes – aber auch für alle anderen ist er leicht im Alltag umzusetzen und hilft dabei, den Blutzucker stabil zu halten (11).
Du möchtest wissen, wie gut dein individuelles Darm-Mikrobiom deine Blutzuckerregulation unterstützt?
Mit dem myBioma Mikrobiom-Test Ultimate hast du die Möglichkeit, ganz einfach mehr über den Zusammenhang zwischen deinem Mikrobiom und verschiedenen Gesundheitsparametern wie der Blutzuckerregulation herauszufinden.
Weitere Informationen zum Umfang und den Inhalten unserer Tests findest du hier: www.myBioma.com
Fazit: Der Darm als Schlüssel zur Glukosekontrolle
Das Mikrobiom beeinflusst den Blutzucker über viele Wege: Entzündungshemmung, SCFAs, Hormonregulation, individuelle Stoffwechselreaktionen – und könnte damit einen wichtigen Beitrag zu zukünftigen, personalisierten Präventions- und Therapiestrategien leisten. Es bedarf jedoch weiterer Forschung und Langzeitstudien, um klinisch anwendbare Strategien zu entwickeln.
Was man schon heute tun kann? Die eigene Darmflora pflegen – durch eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und möglichst wenig hochverarbeitete Lebensmittel. Denn auch wenn noch nicht alle Antworten gefunden sind, zeigt sich eines deutlich: Ein gesunder Darm ist ein stark unterschätzter Einflussfaktor zu einer gesunden Blutzuckerregulation. 💚
Du möchtest Produkt-News als Erste*r erfahren und exklusive Rabatte, Rezepte und mehr erhalten? Dann werde jetzt Teil unseres HAPPY GUT CLUBs auf WhatsApp: myBioma Happy Gut Club
Für dich. Für deinen Darm.
Referenzen
- Nakrani MN, Wineland RH, Anjum F. Physiology, Glucose Metabolism. [Updated 2023 Jul 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560599/
- Booth, S. (2024). Insulin Resistance – What You Need to Know. WebMD. https://www.webmd.com/diabetes/insulin-resistance-syndrome
- Palmnäs-Bédard, M. S., Costabile, G., Vetrani, C., Åberg, S., Hjalmarsson, Y., Dicksved, J., Riccardi, G., & Landberg, R. (2022). The human gut microbiota and glucose metabolism: A scoping review of key bacteria and the potential role of SCFAs. The American Journal of Clinical Nutrition, 116(4), 862–874. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac217
- Anhê, F. F., Barra, N. G., & Schertzer, J. D. (2020). Glucose alters the symbiotic relationships between gut microbiota and host physiology. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 318(2), E111–E116. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00485.2019
- Utzschneider, K. M., Kratz, M., Damman, C. J., & Hullarg, M. (2016). Mechanisms Linking the Gut Microbiome and Glucose Metabolism. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 101(4), 1445–1454. https://doi.org/10.1210/jc.2015-4251
- Dulai, A. S., Min, M., & Sivamani, R. K. (2024). The Gut Microbiome’s Influence on Incretins and Impact on Blood Glucose Control. Biomedicines, 12(12), 2719. https://doi.org/10.3390/biomedicines12122719
- Fu, Y., Gou, W., Zhong, H., Tian, Y., Zhao, H., Liang, X., Shuai, M., Zhuo, L.-B., Jiang, Z., Tang, J., Ordovas, J. M., Chen, Y., & Zheng, J.-S. (2025). Diet-gut microbiome interaction and its impact on host blood glucose homeostasis: A series of nutritional n-of-1 trials. eBioMedicine, 111. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105483
- Diabetes Research Connection. (2023, Dezember 19). 42 Factors That Affect Blood Glucose. https://diabetesresearchconnection.org/42-factors-affect-blood-glucose/
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (o. J.). Die DGE Empfehlungen: Obst und Gemüse – viel und bunt. https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/obst-und-gemuese/
- Slavin J. Fiber and Prebiotics: Mechanisms and Health Benefits. Nutrients. April 2013;5(4):1417–35.
- Nesti, L., Mengozzi, A., & Tricò, D. (2019). Impact of Nutrient Type and Sequence on Glucose Tolerance: Physiological Insights and Therapeutic Implications. Frontiers in Endocrinology, 10, 144. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00144